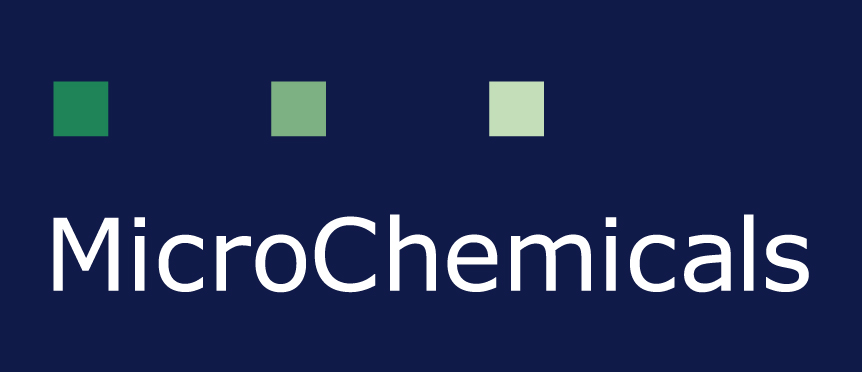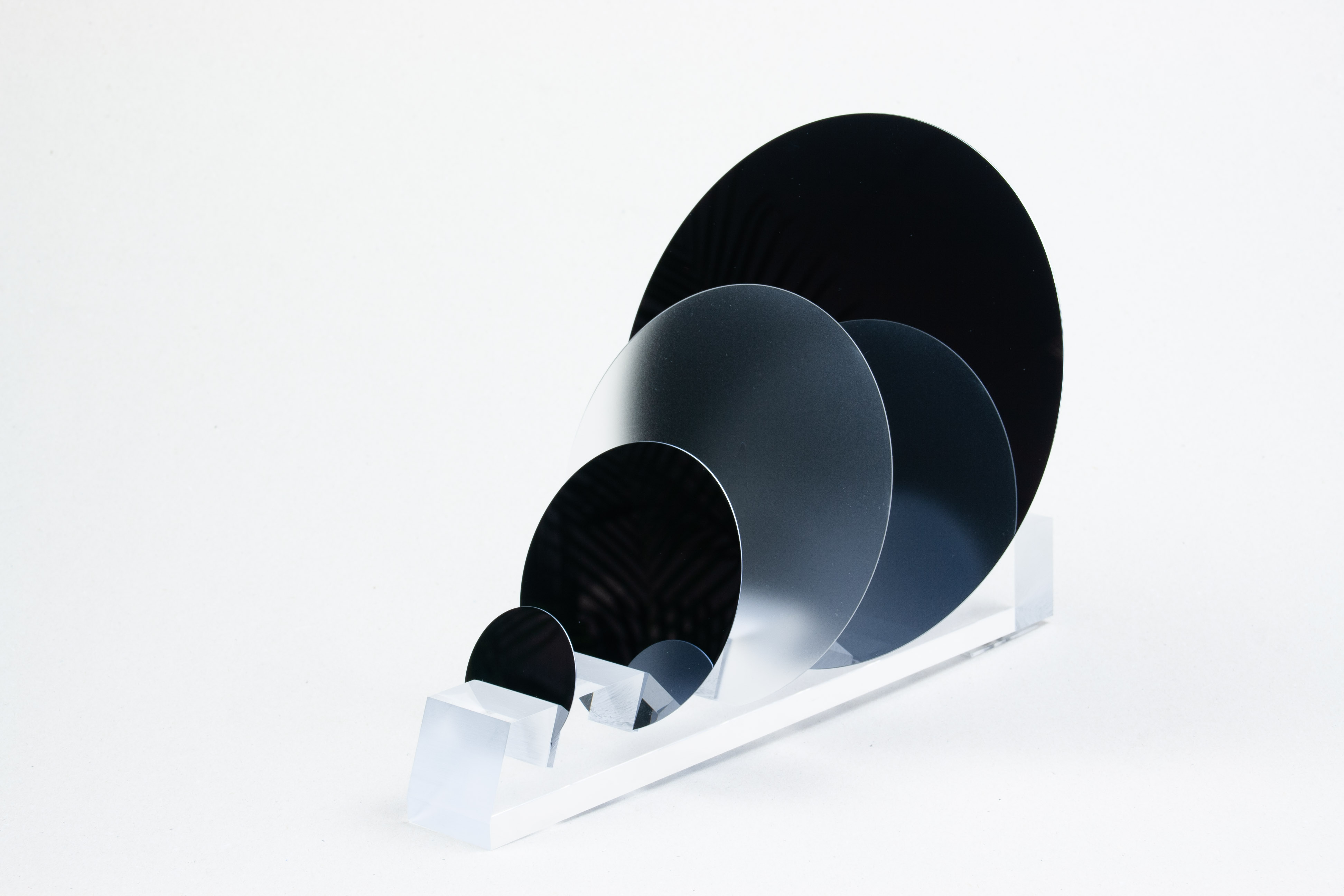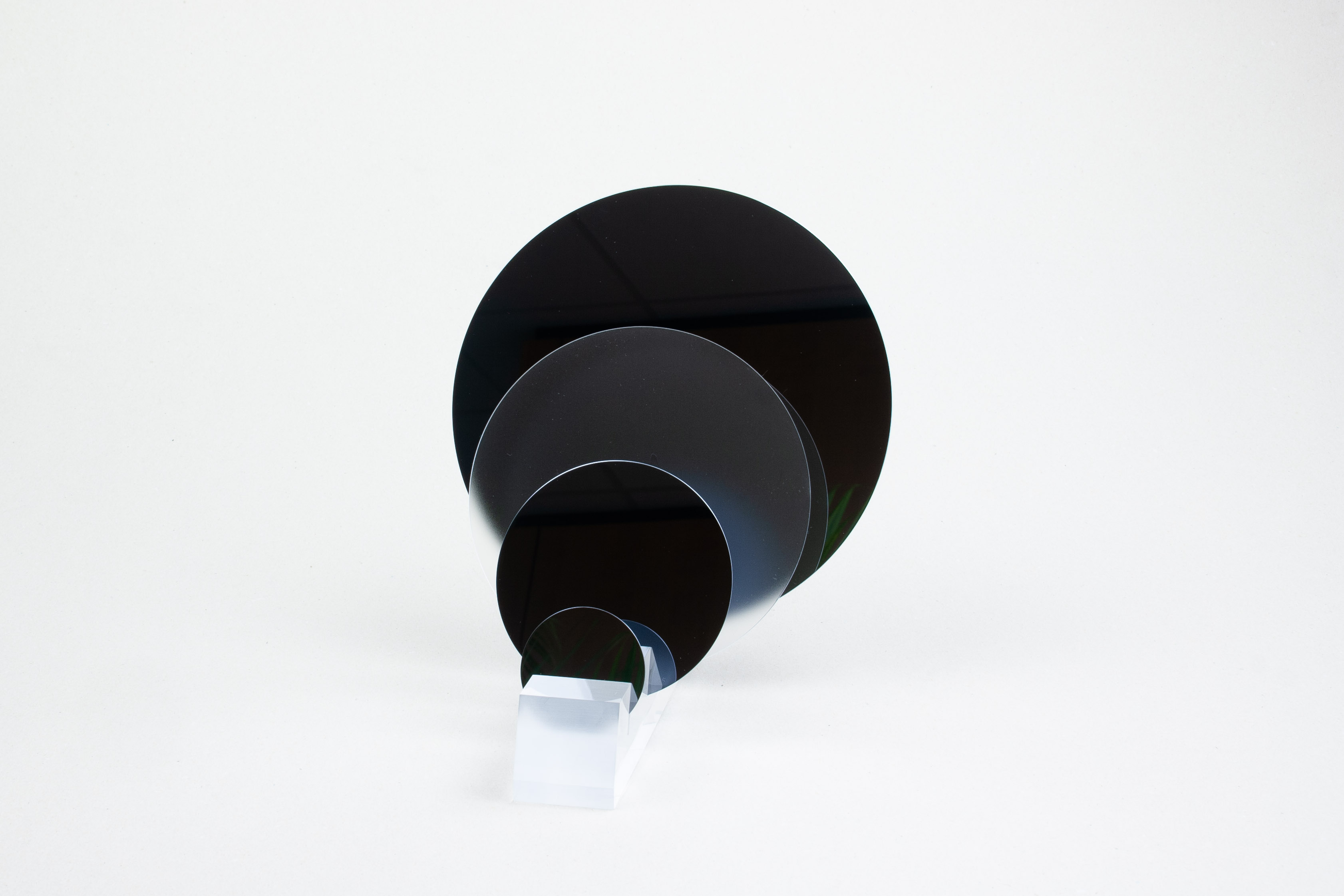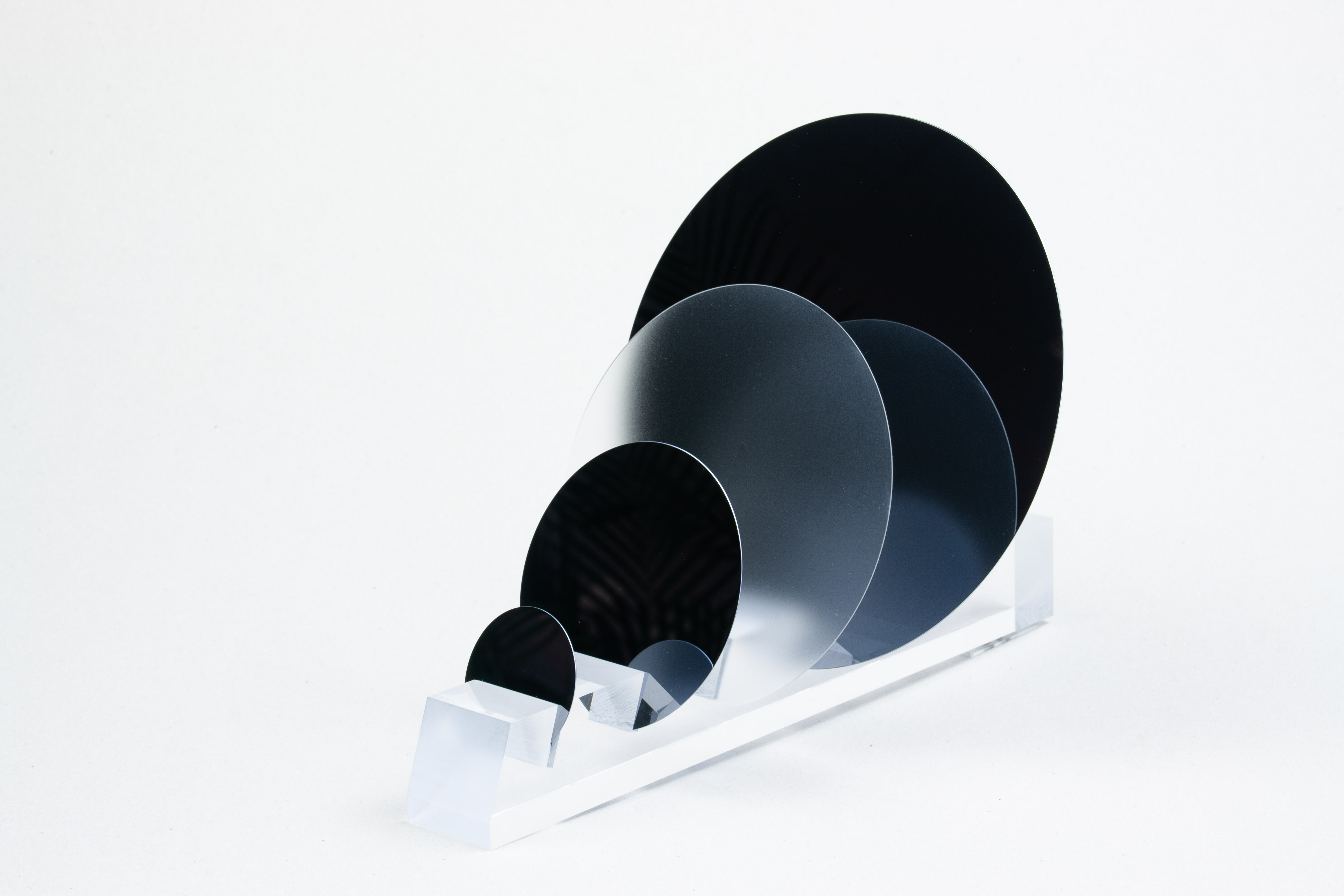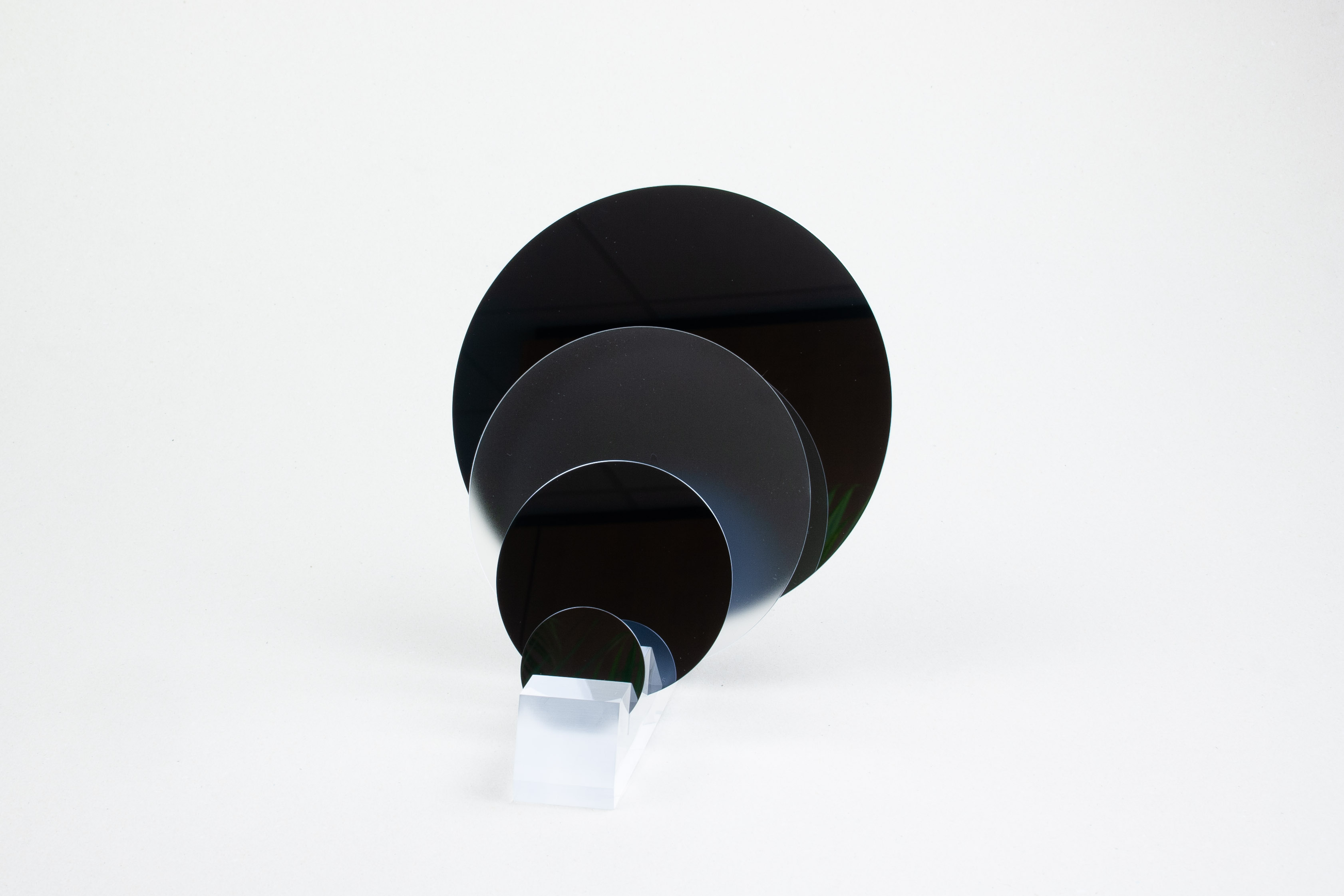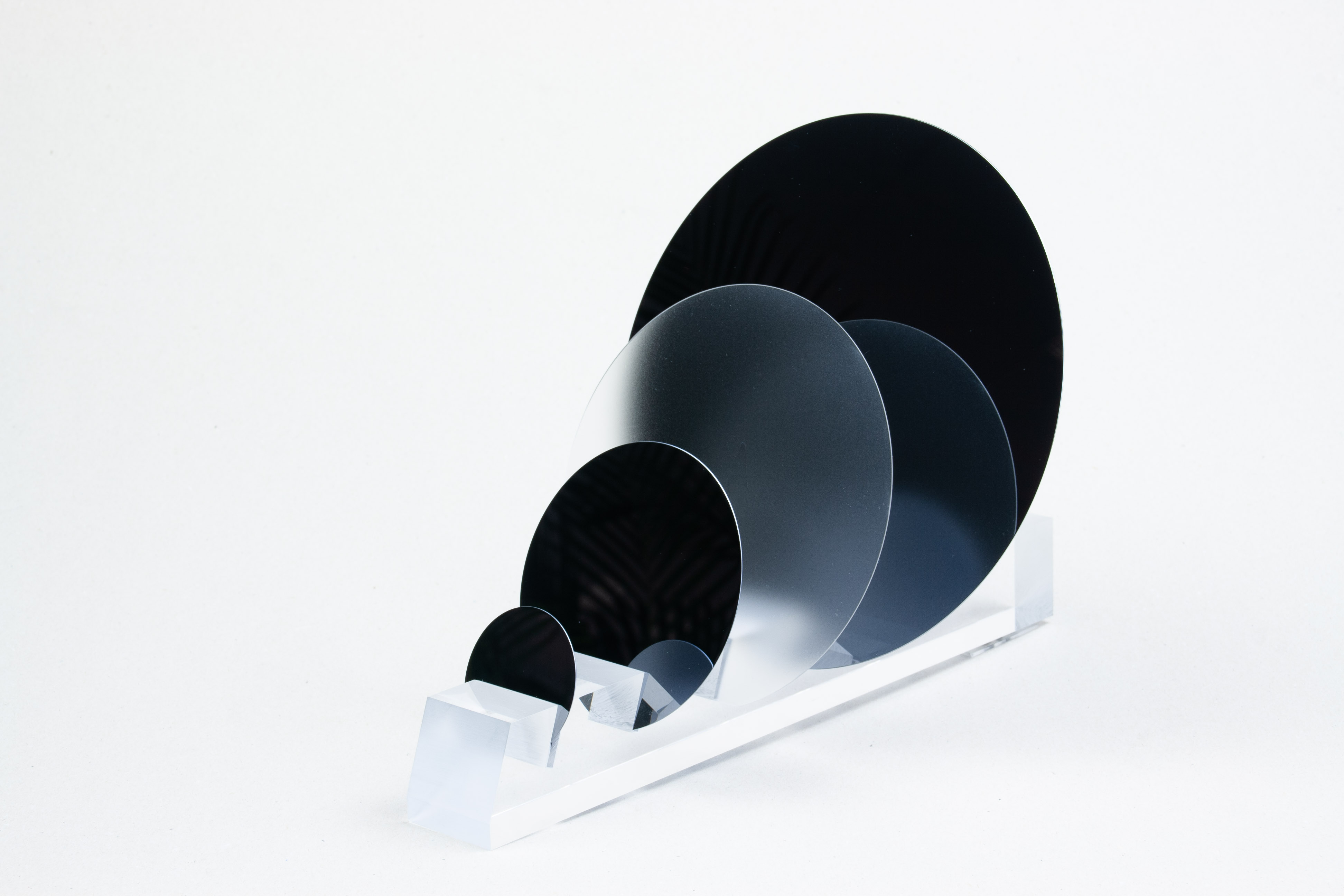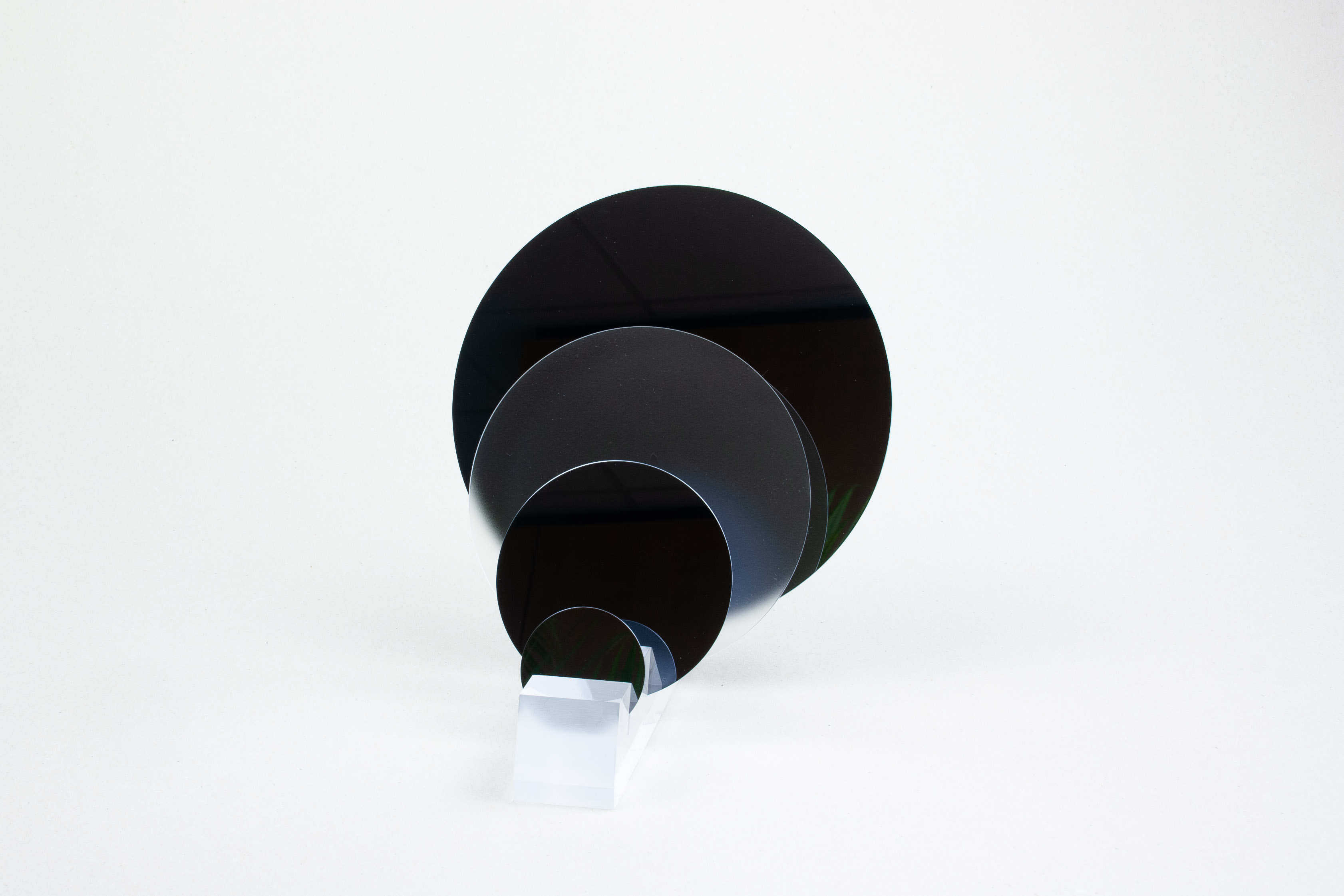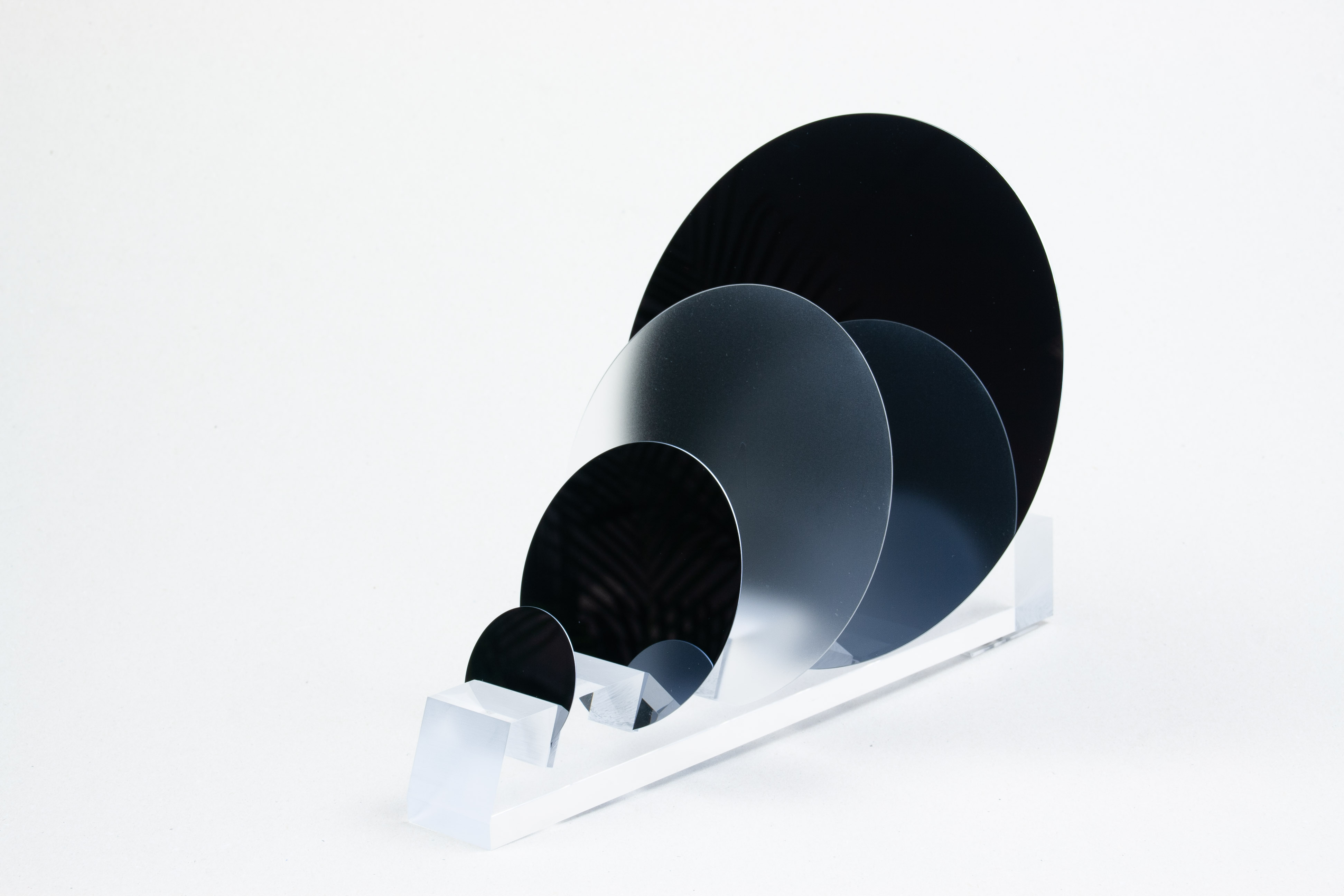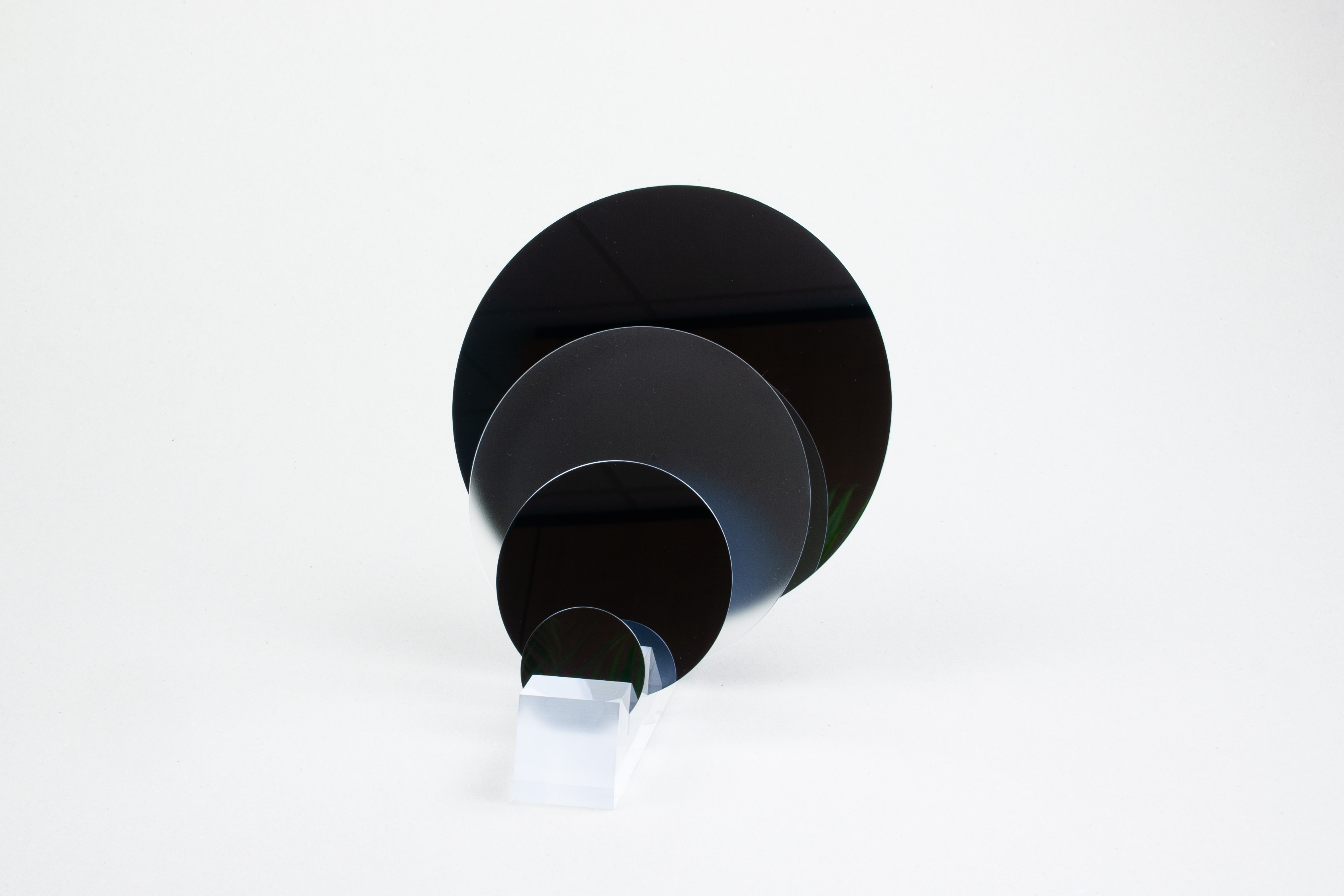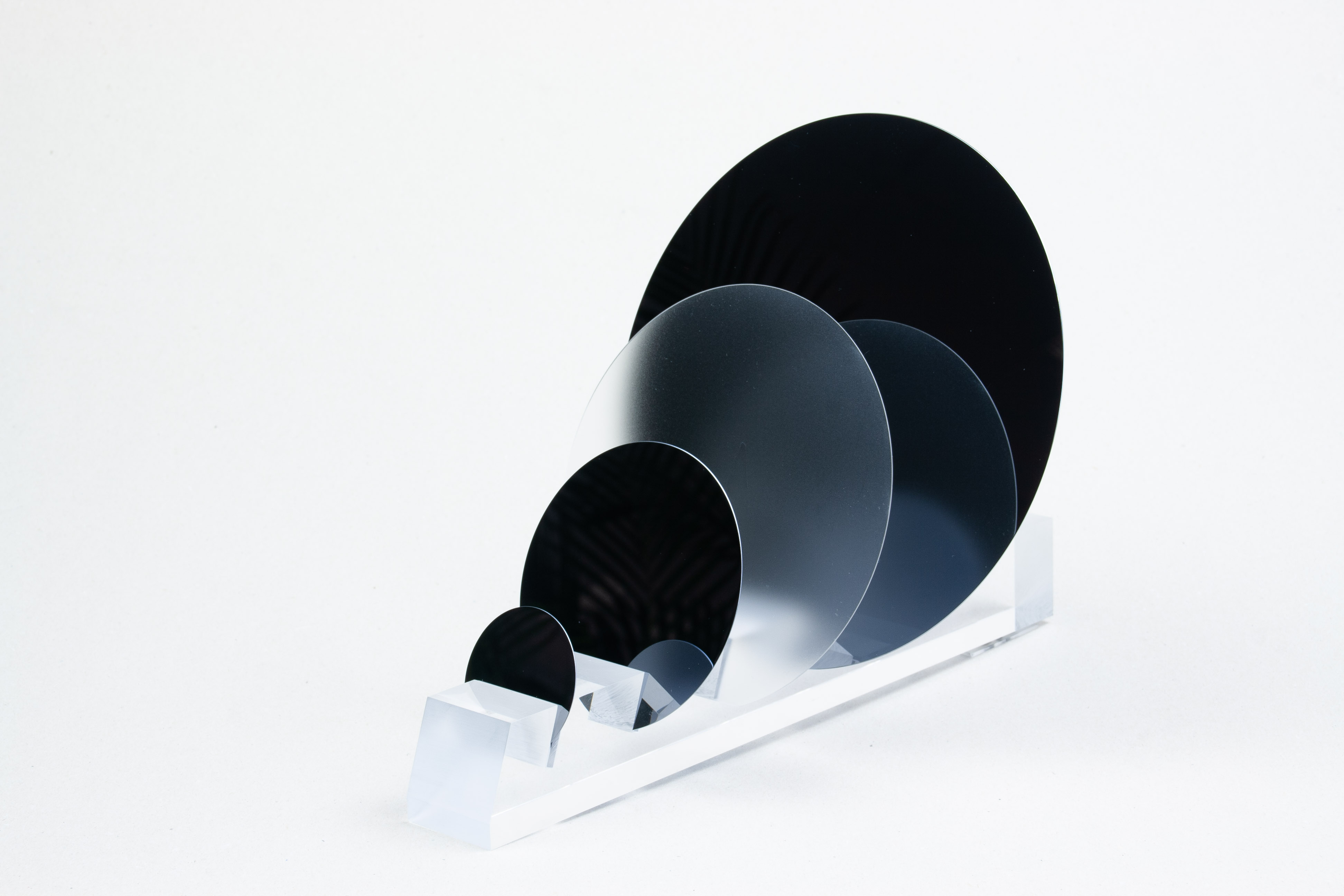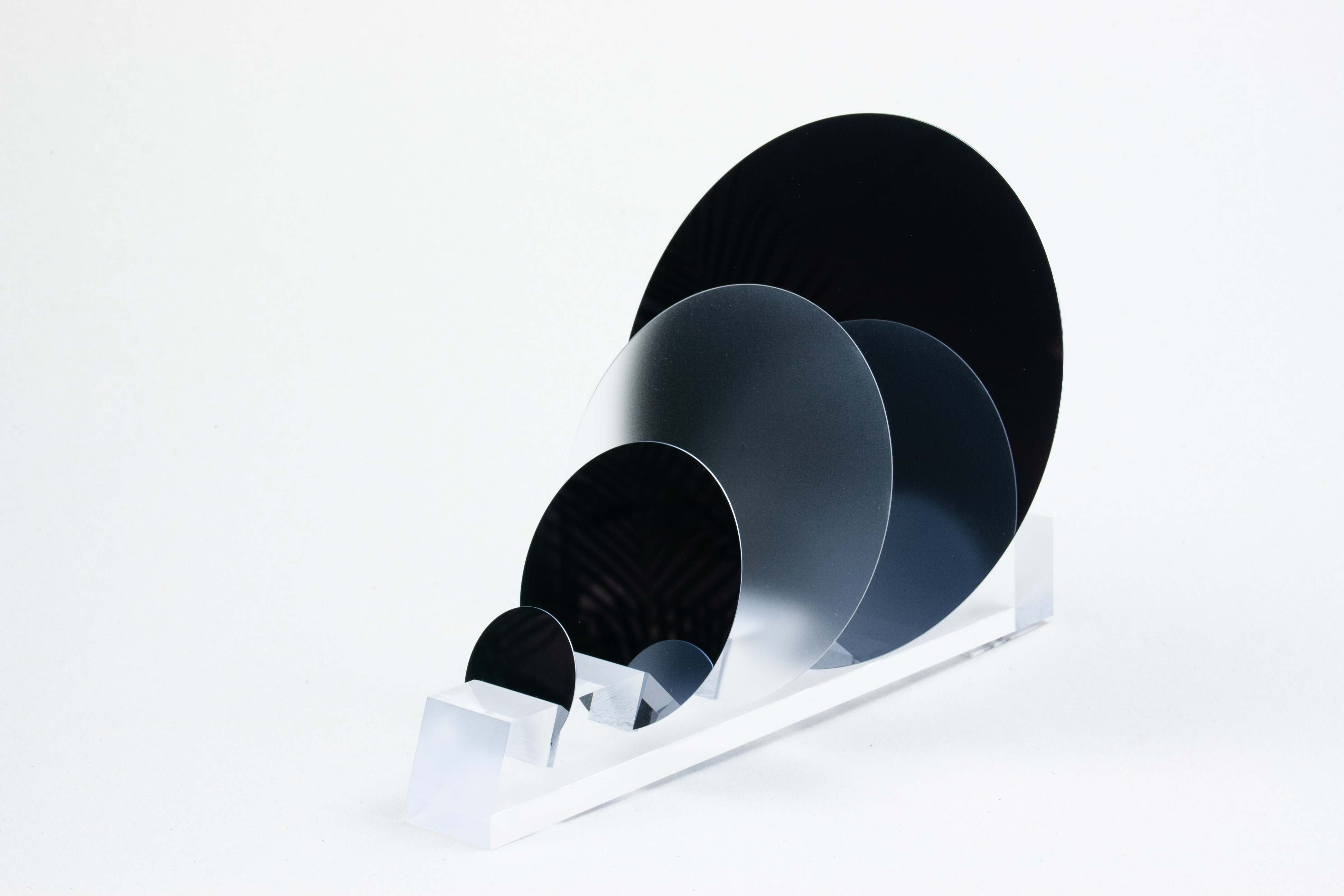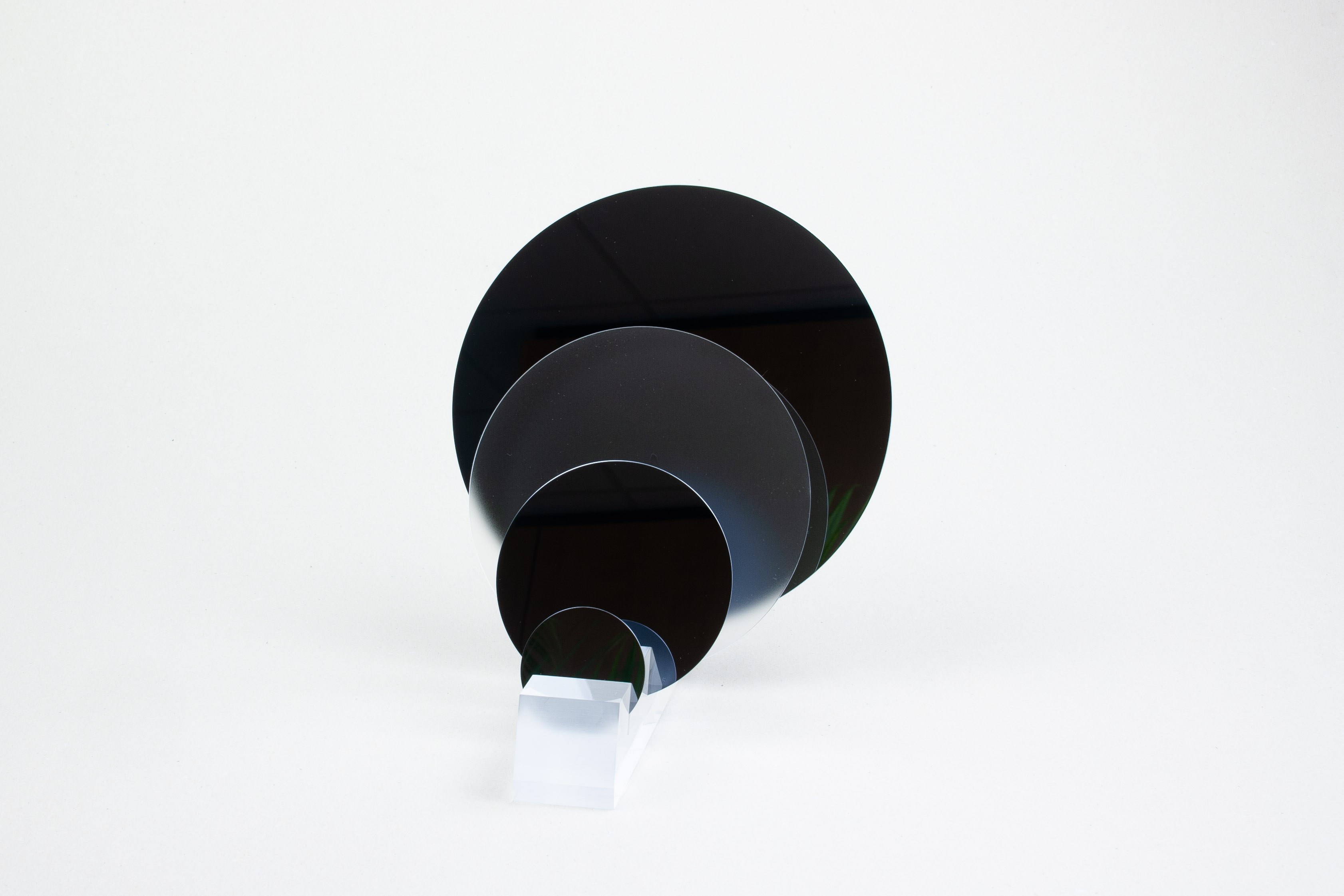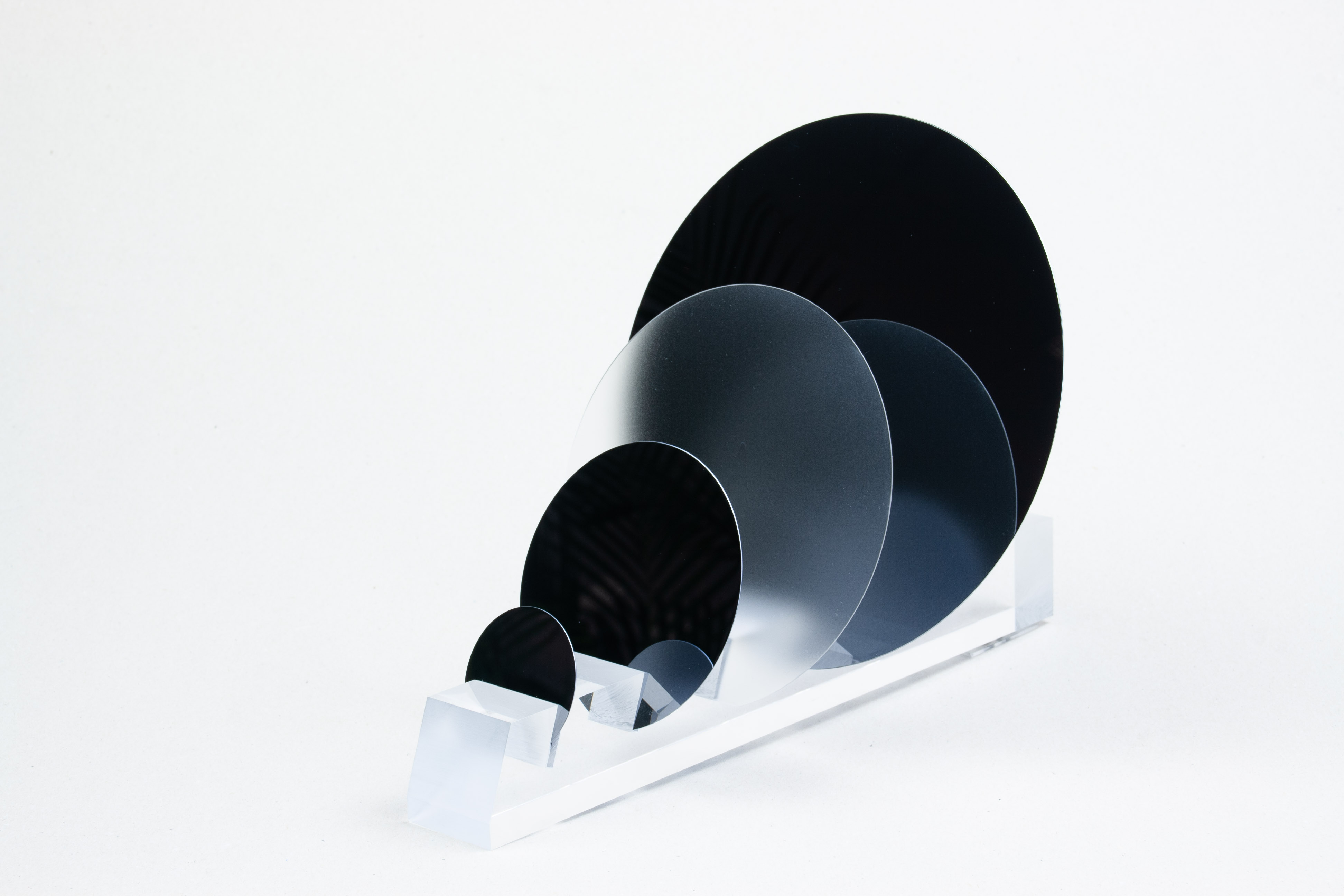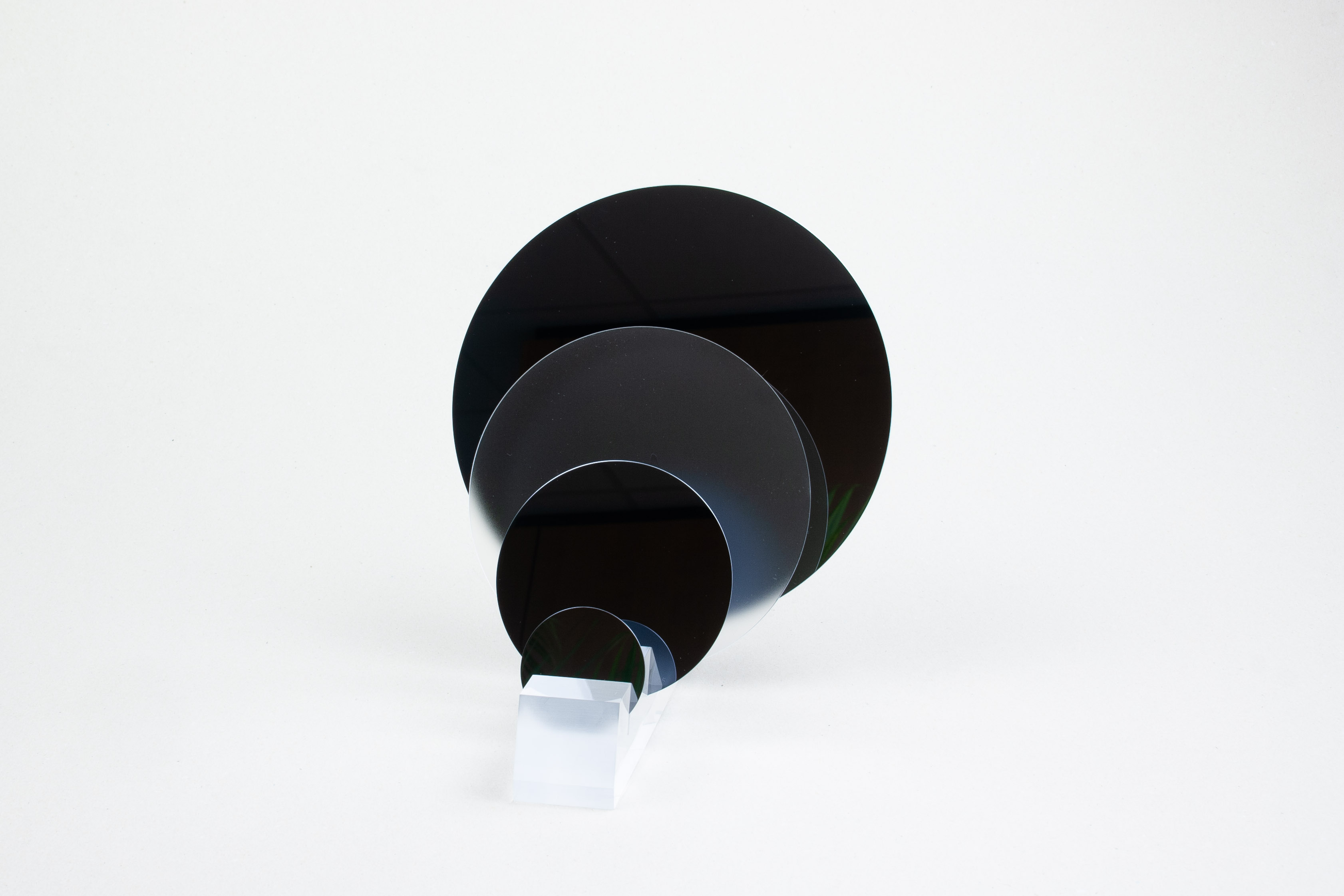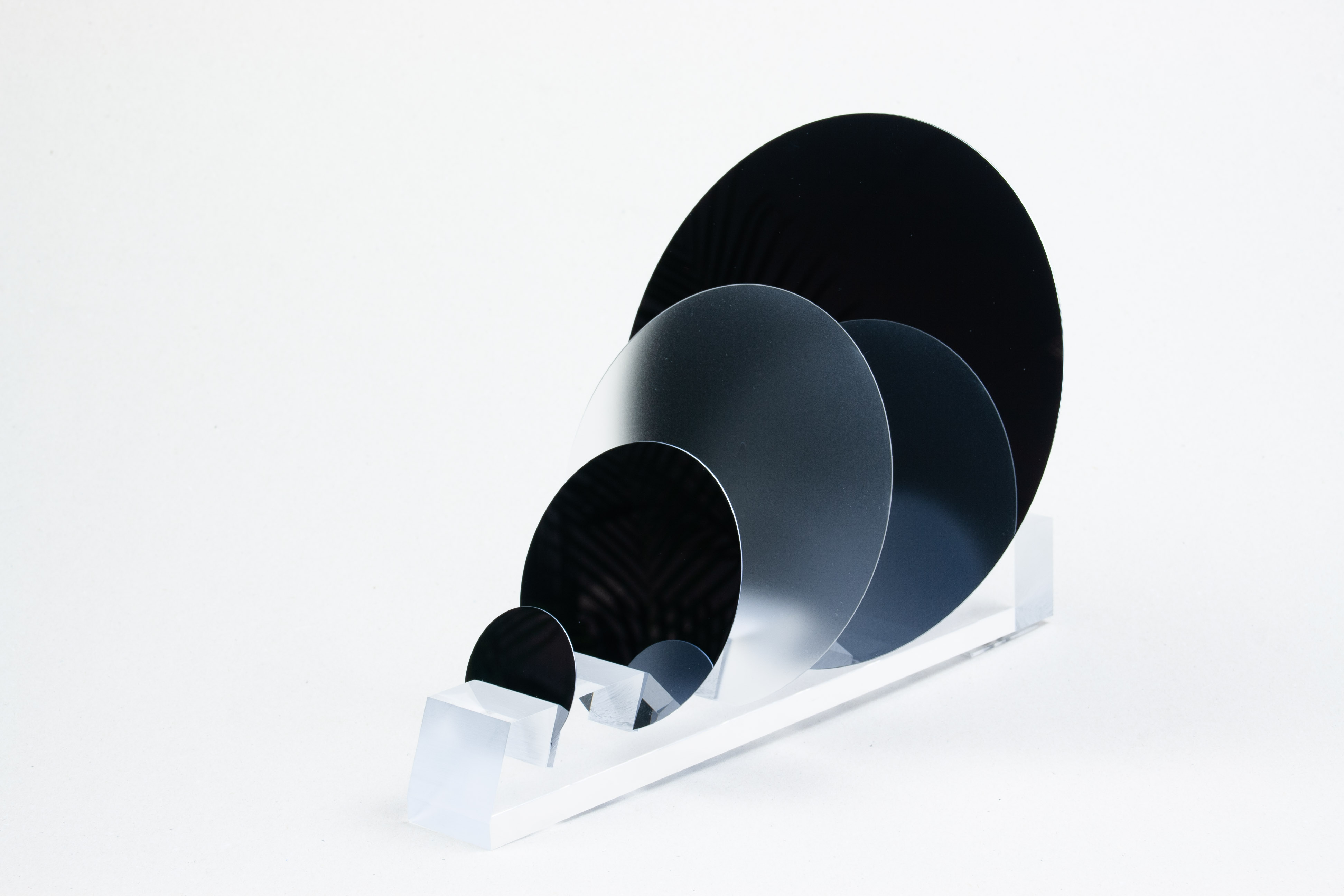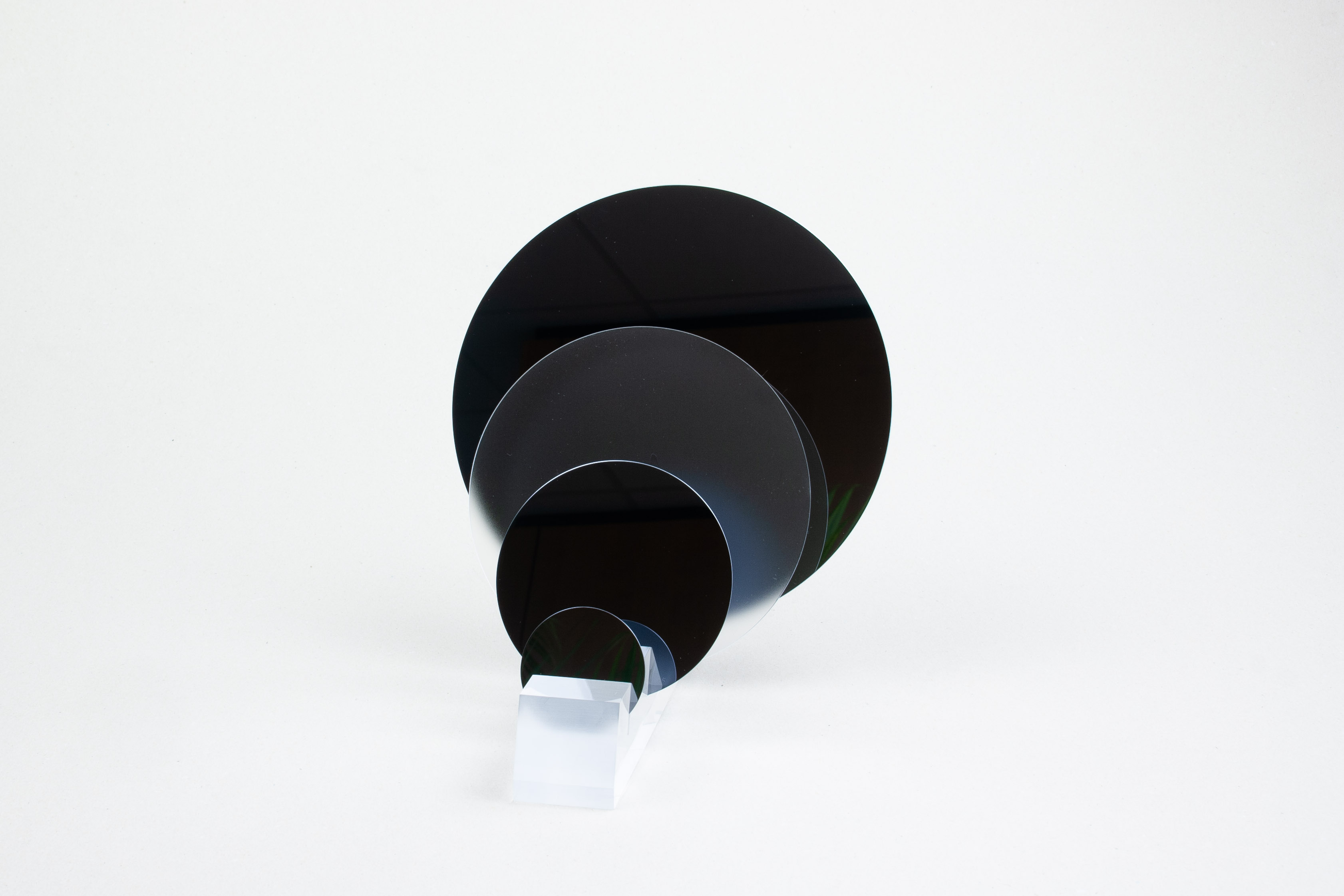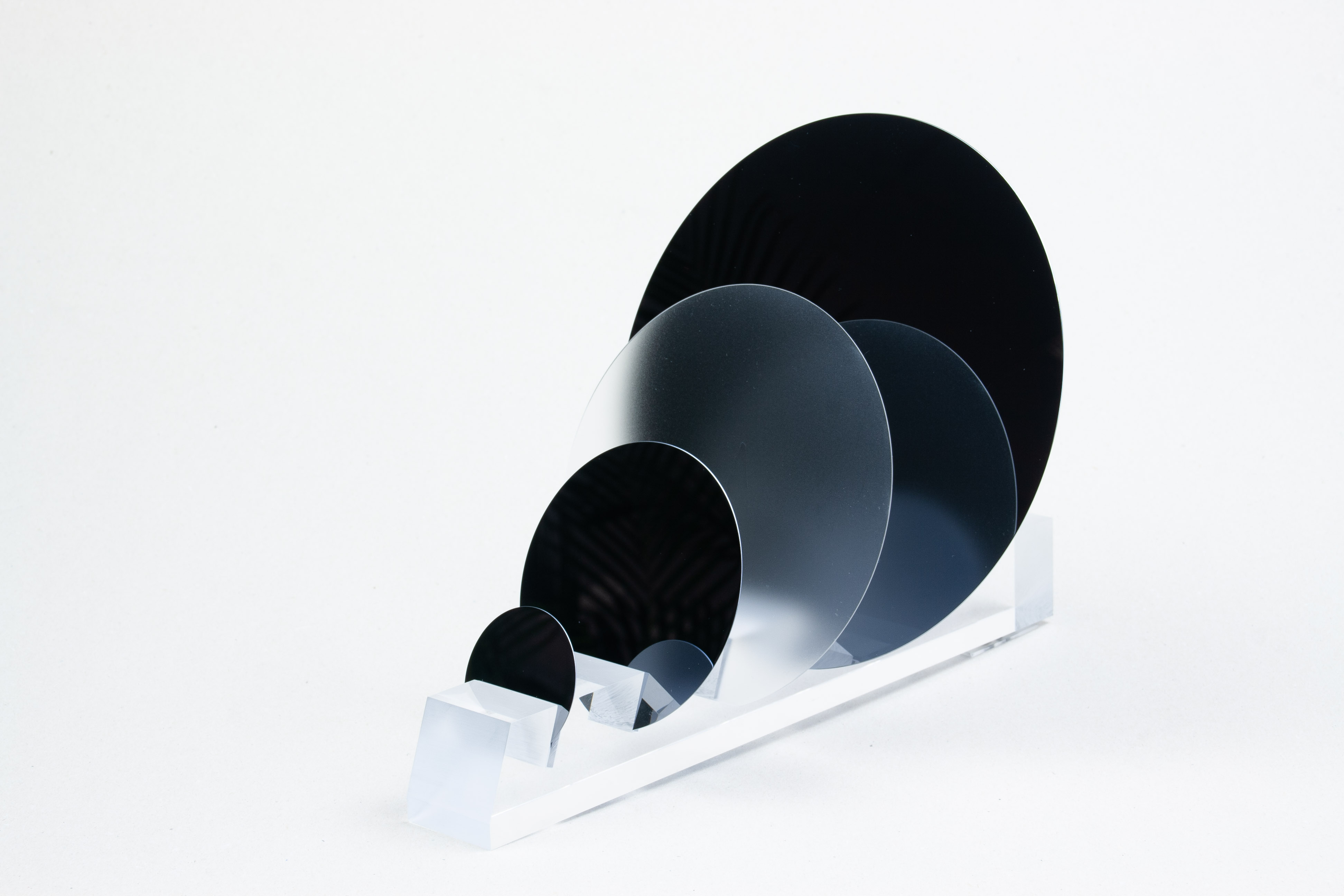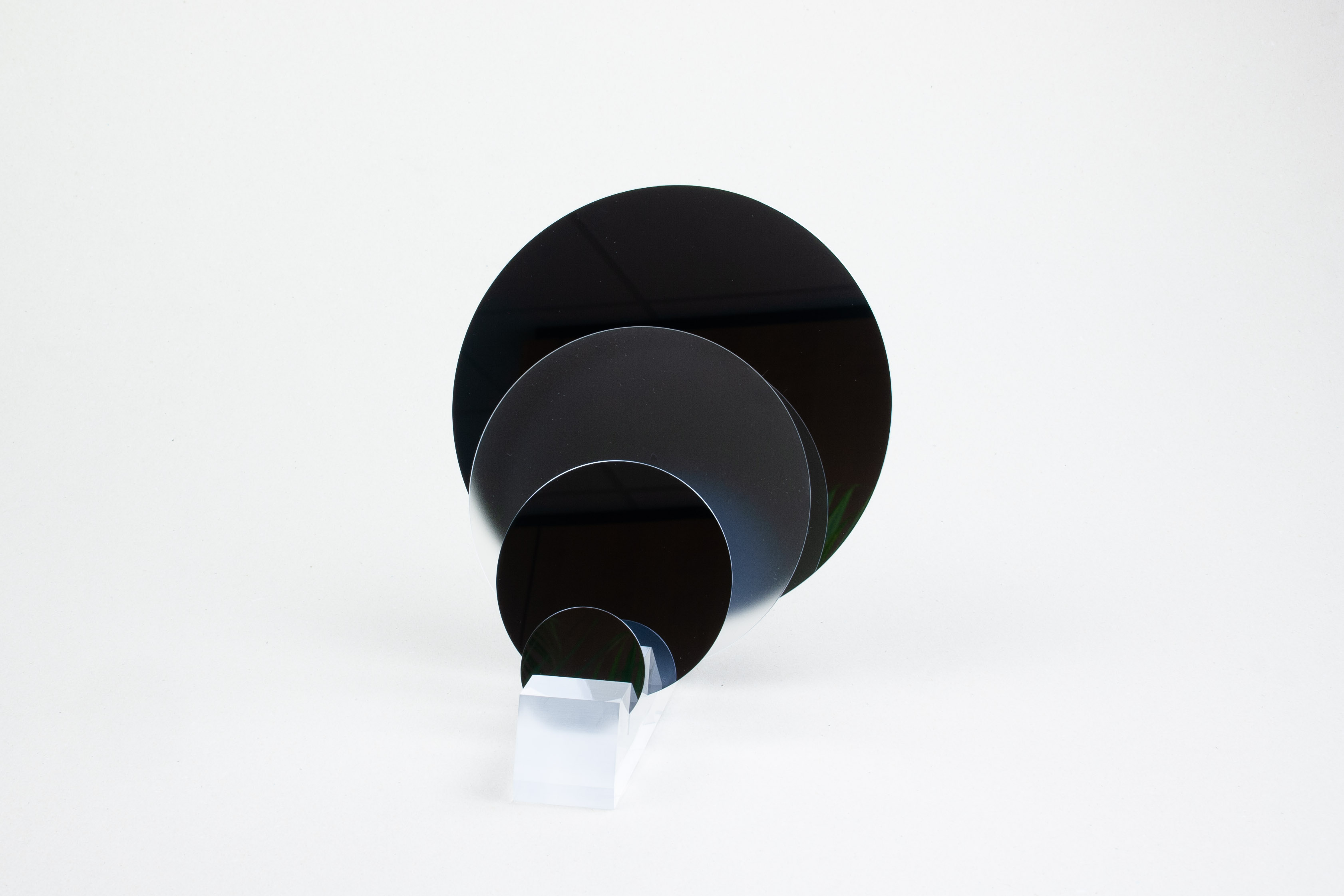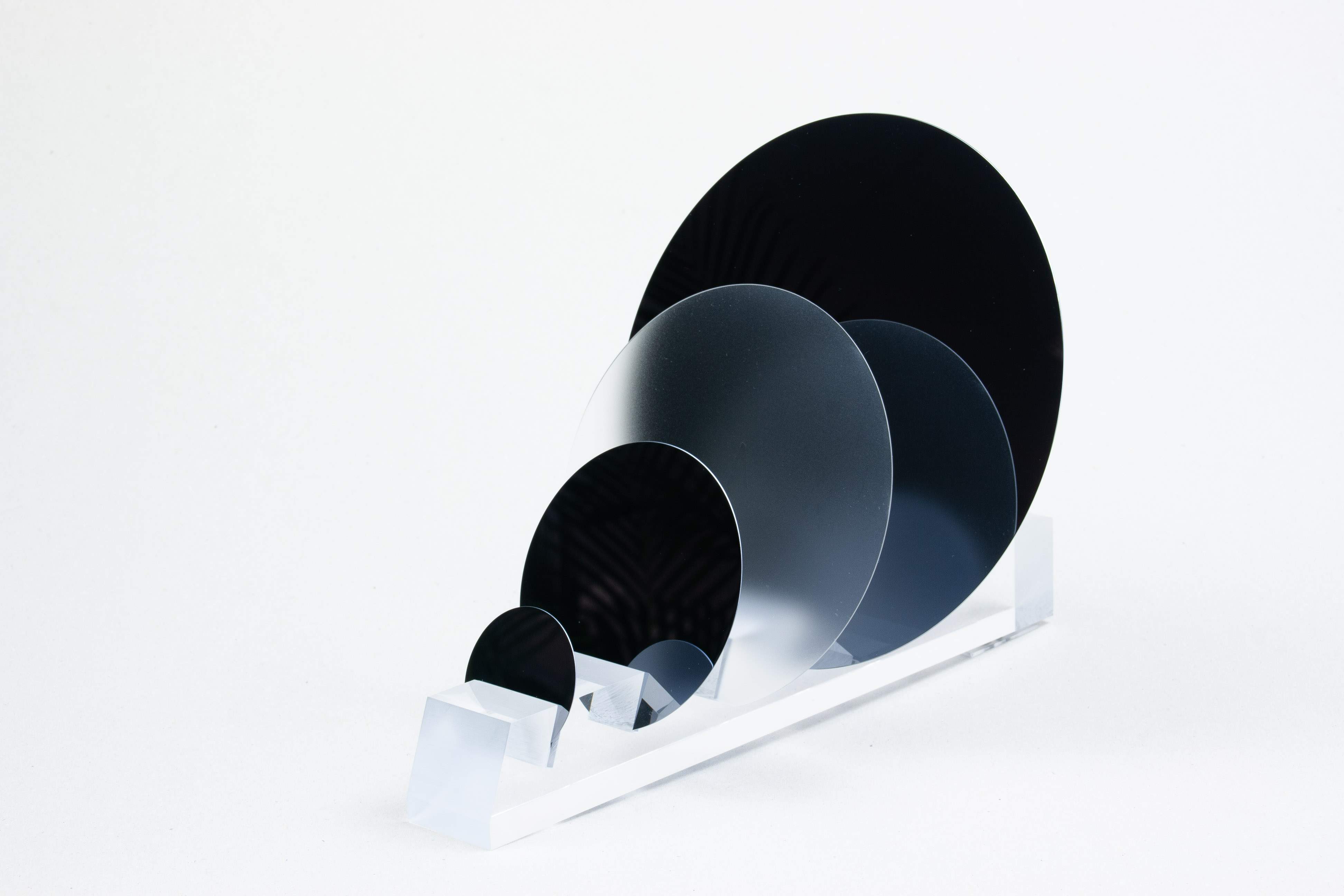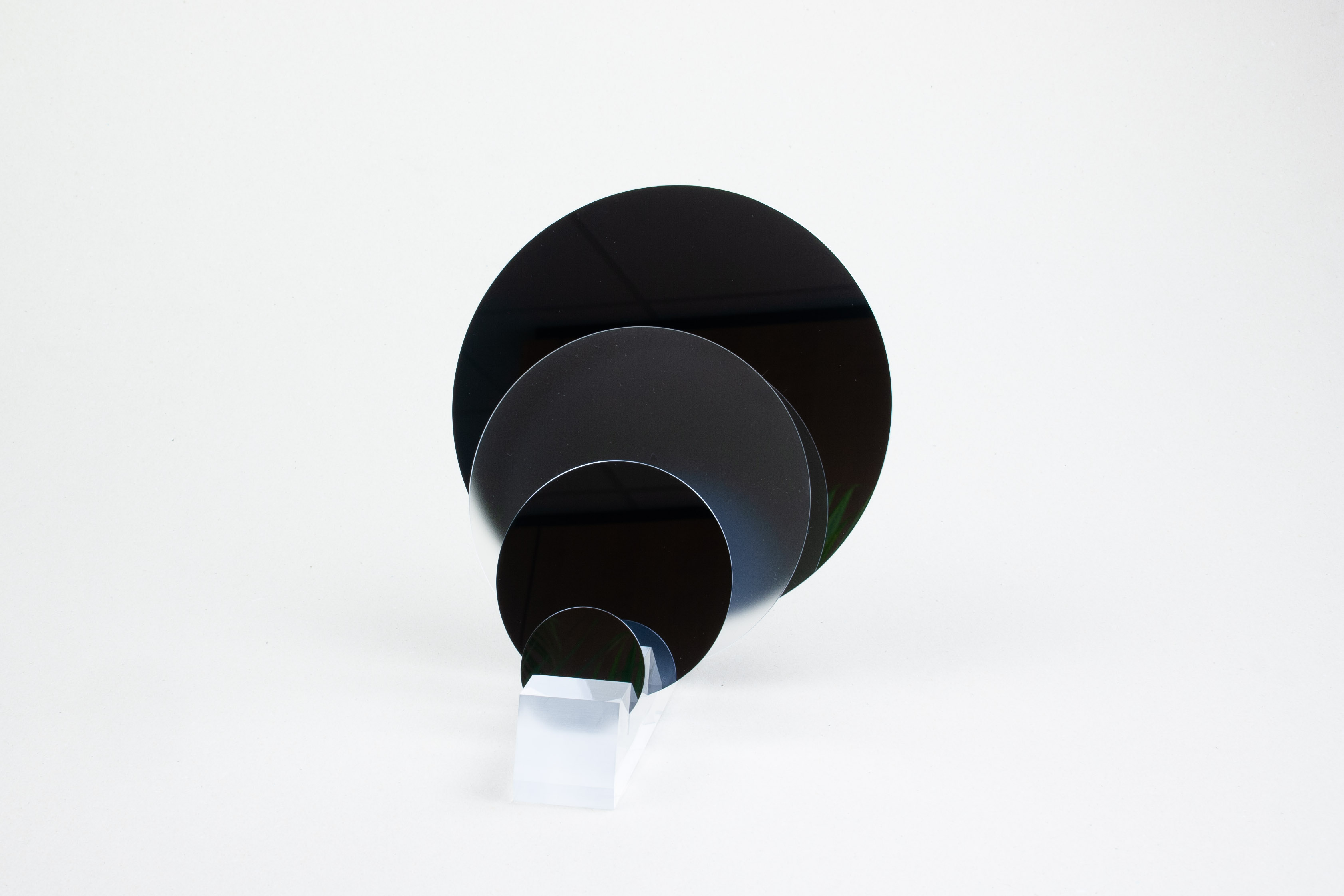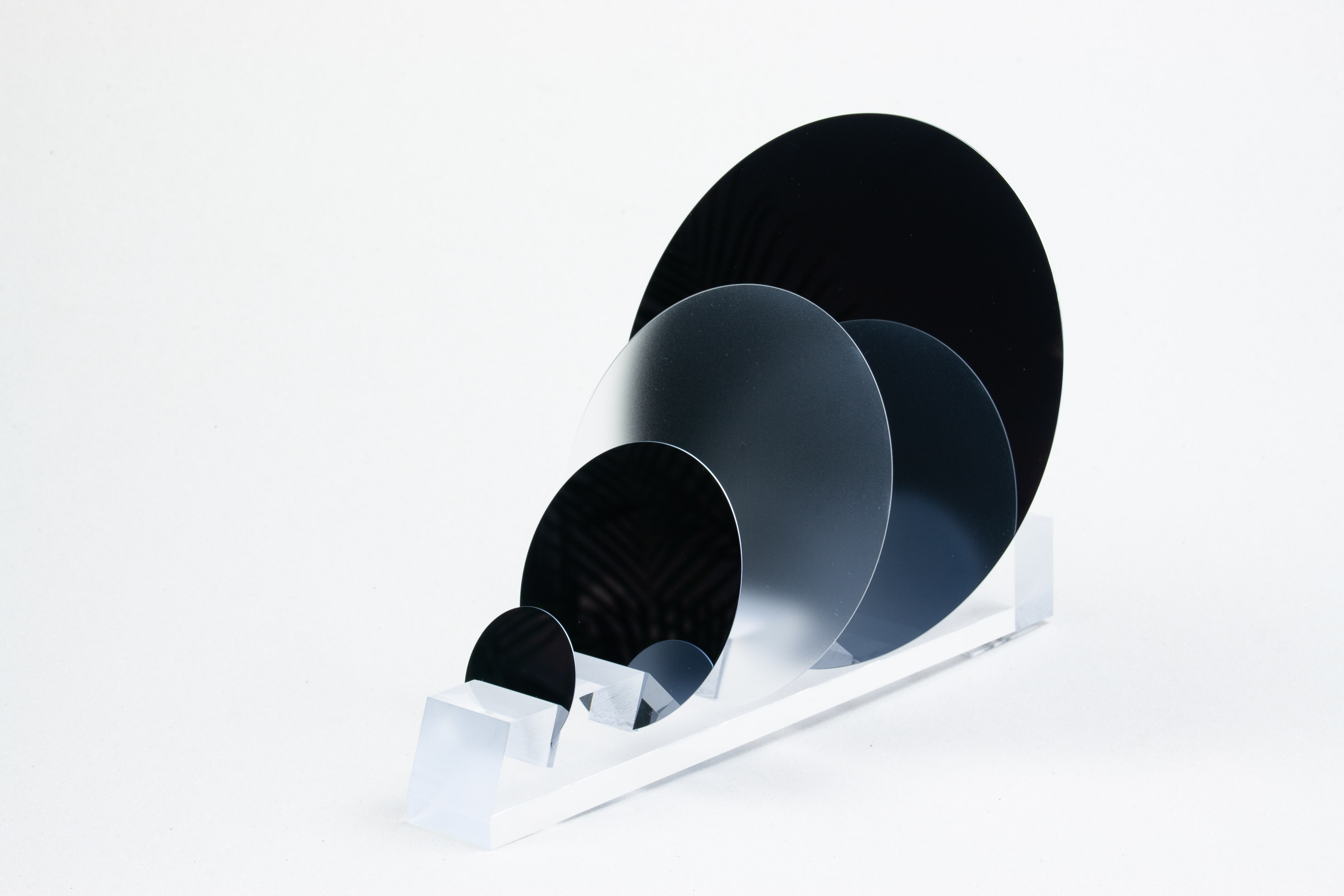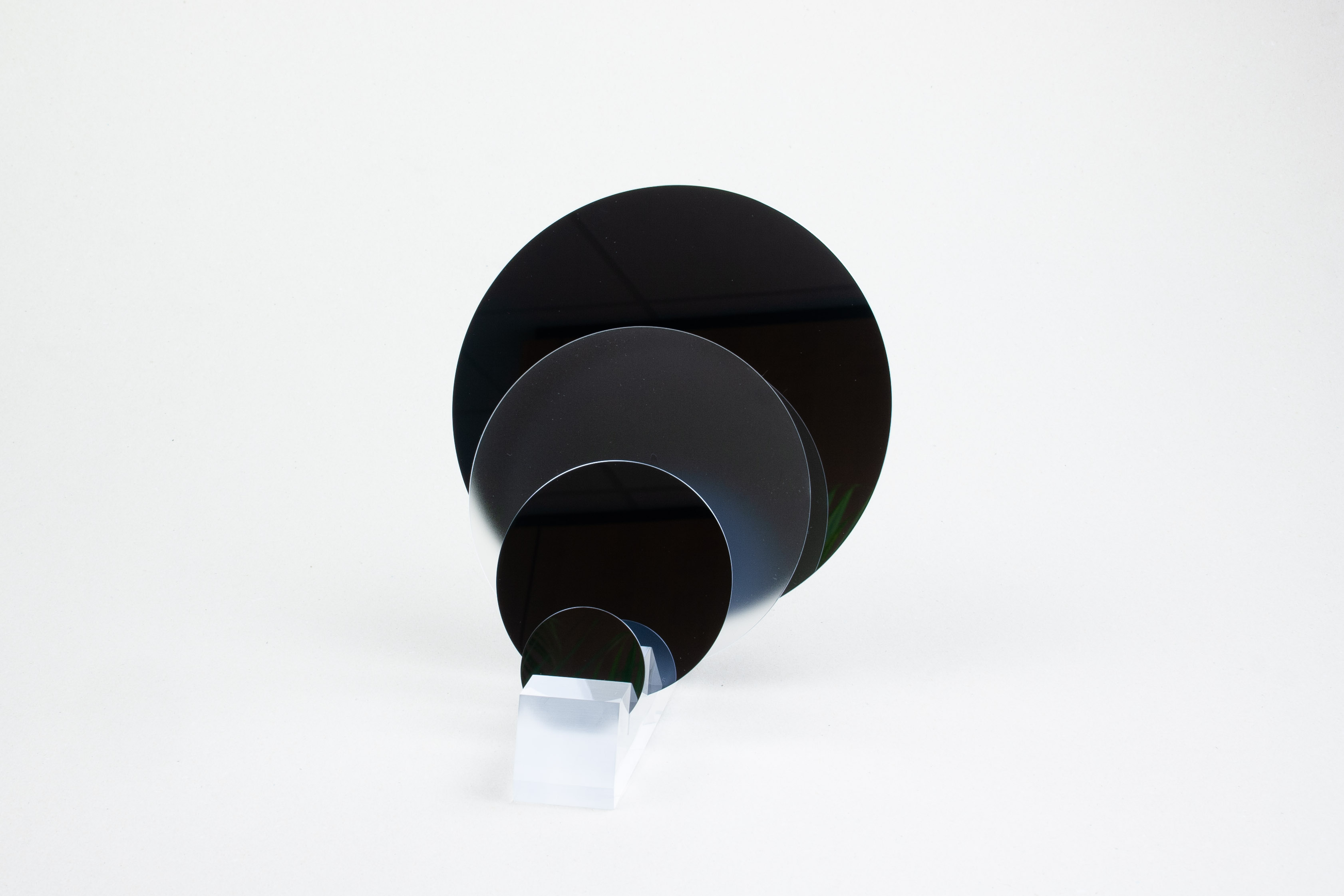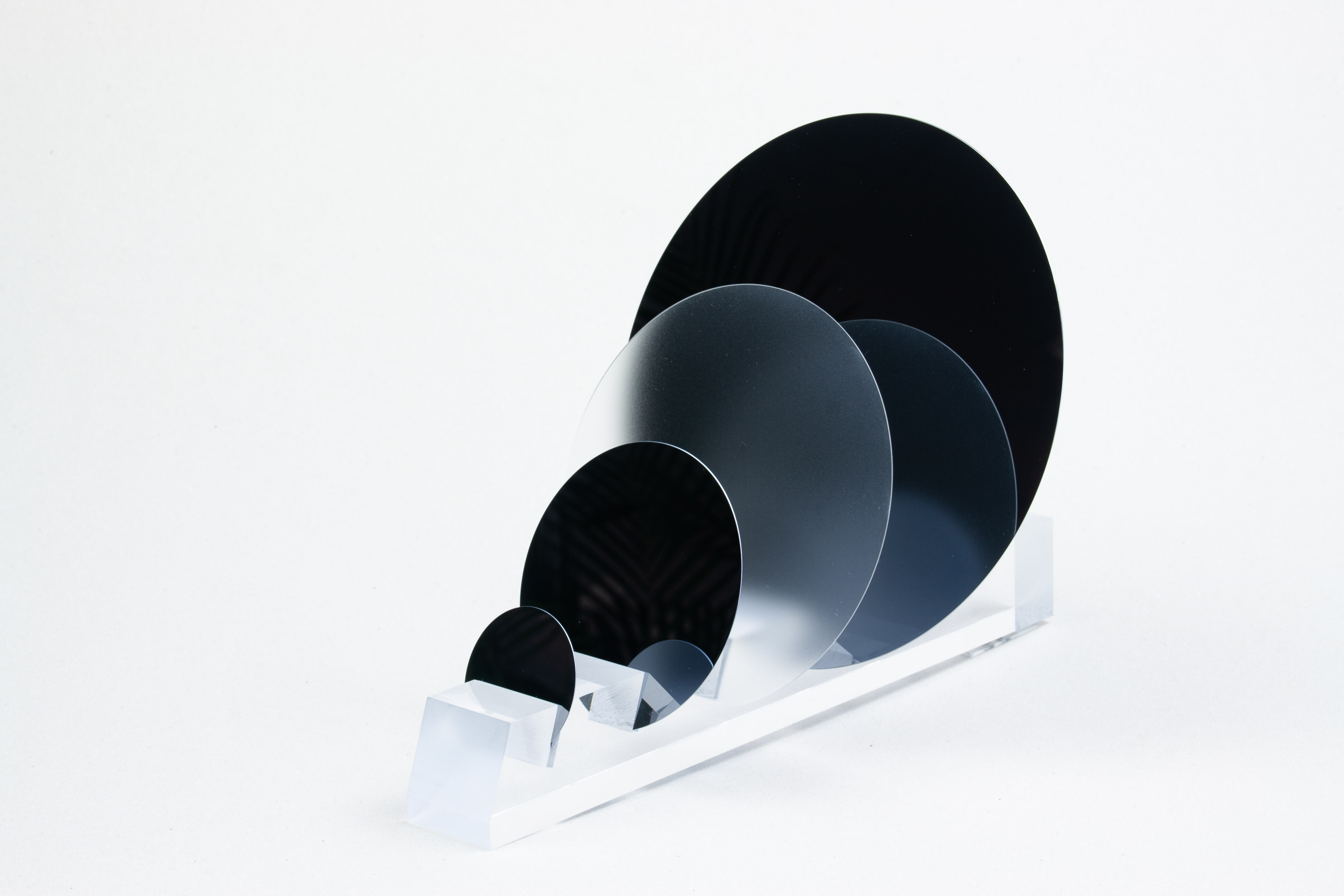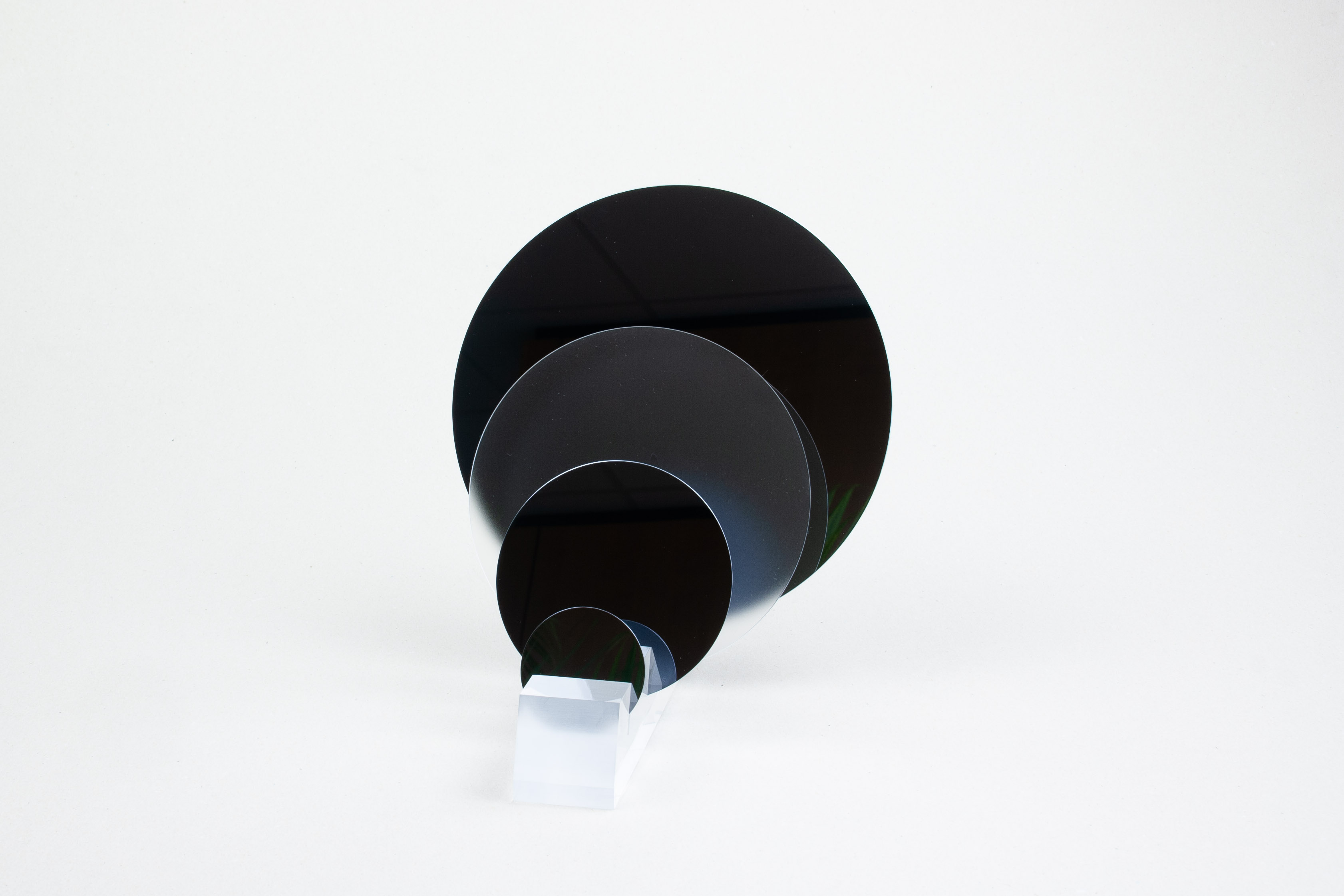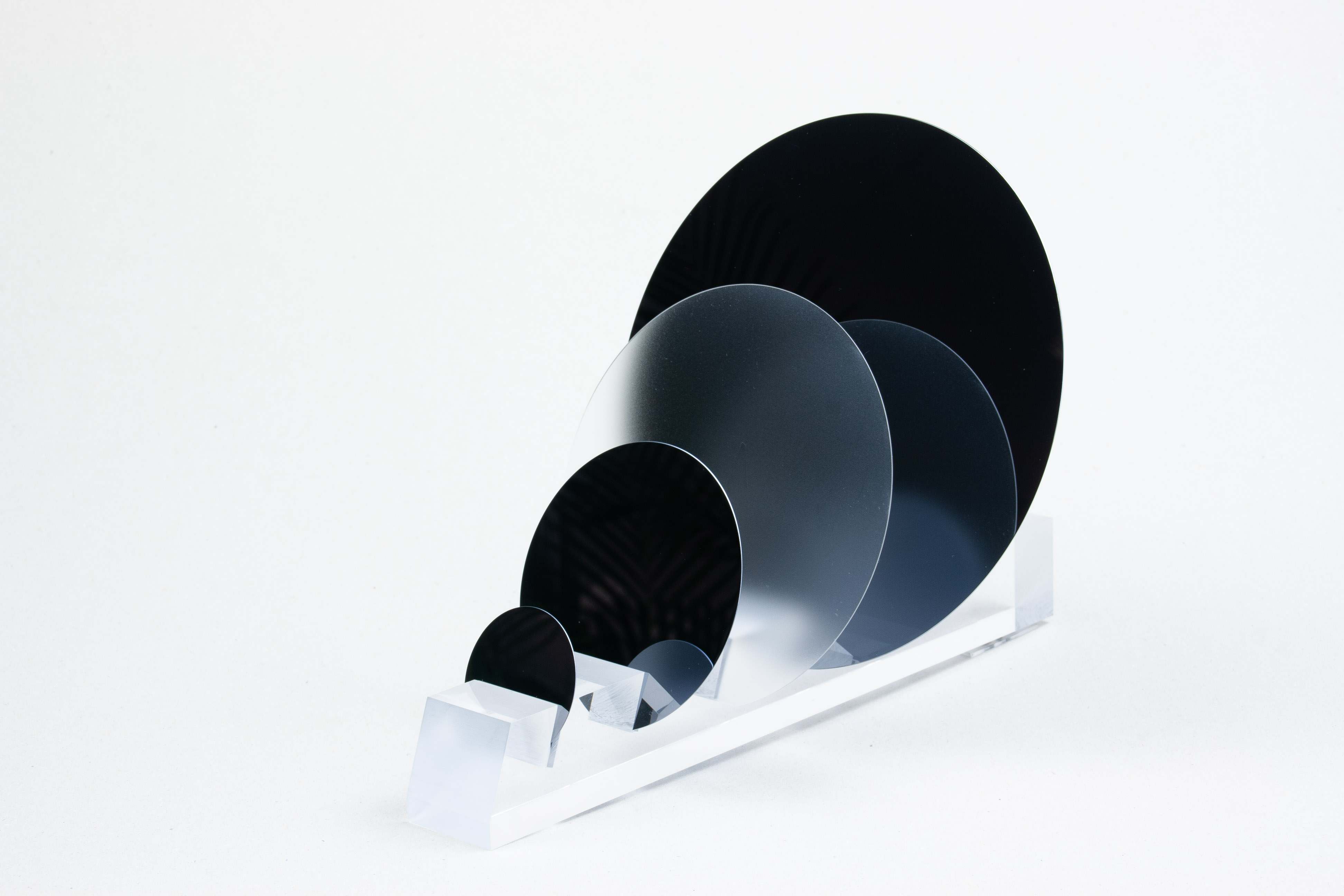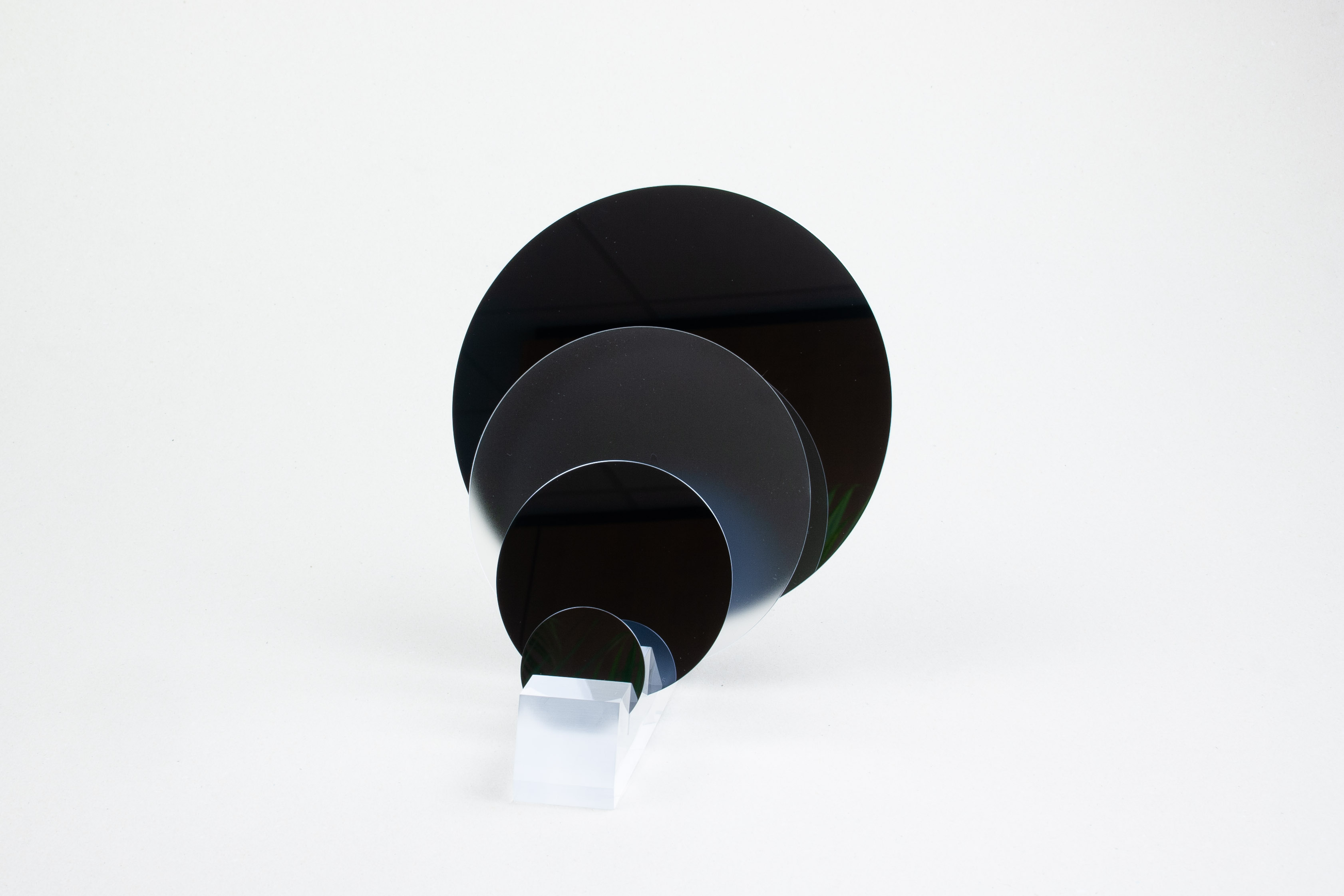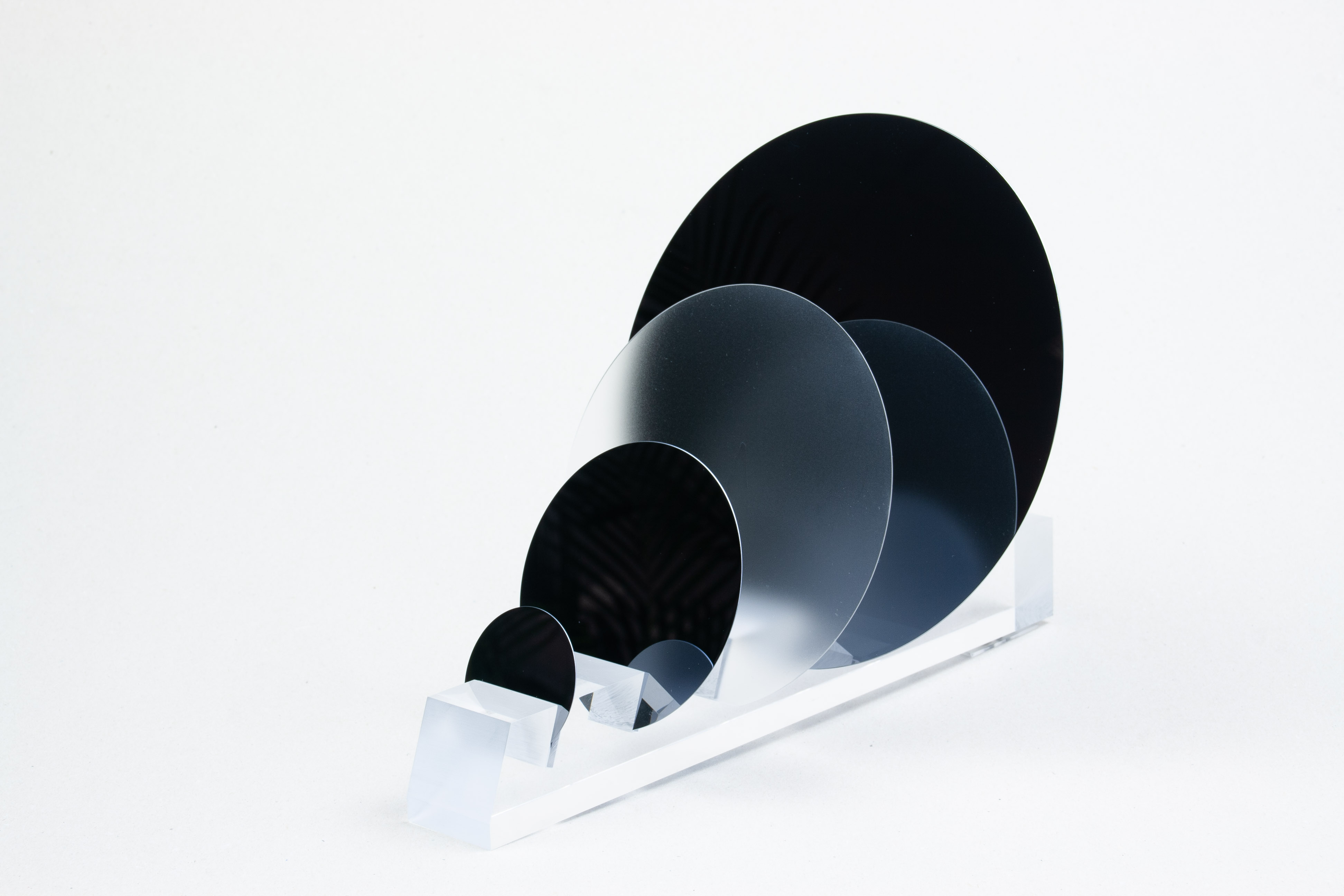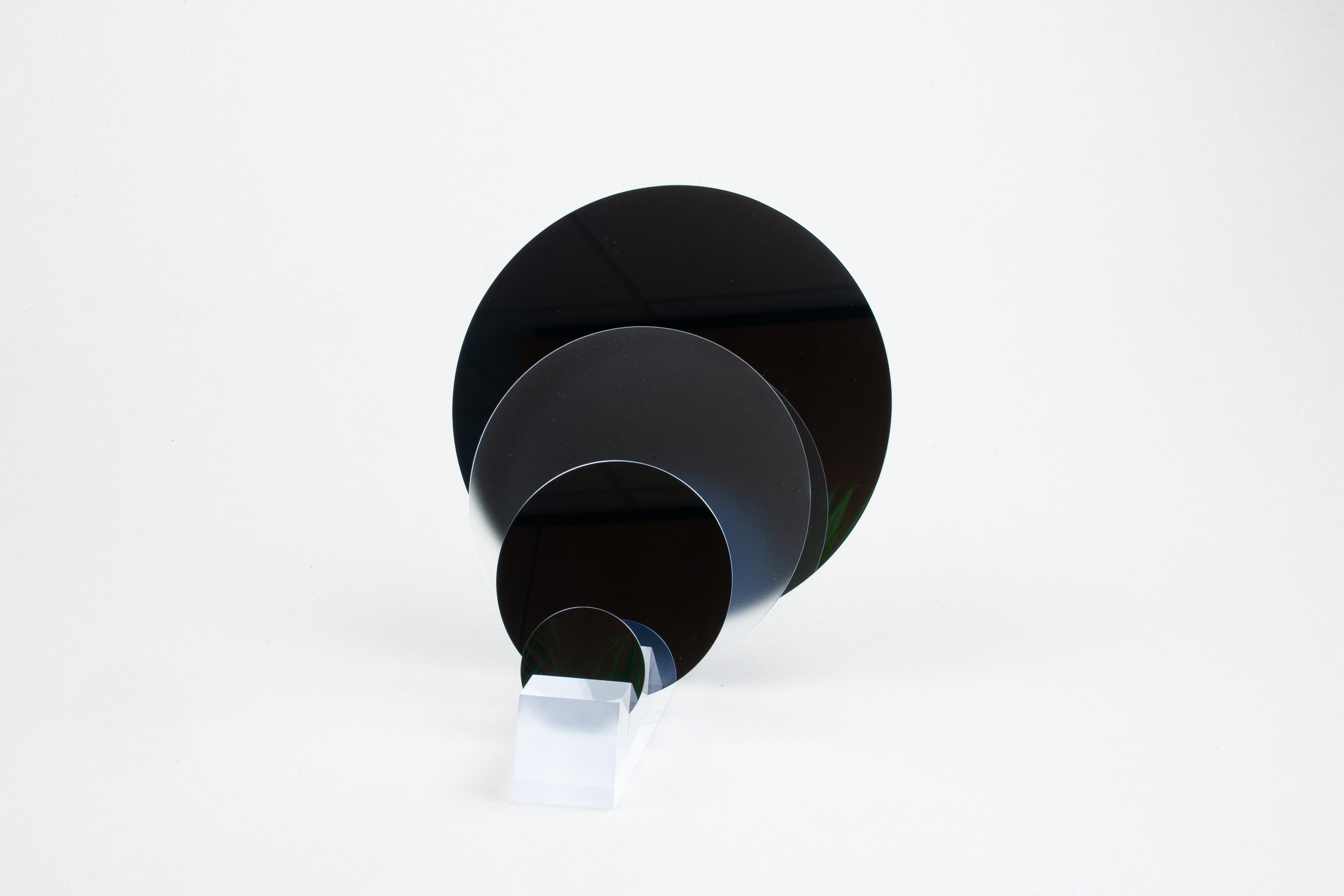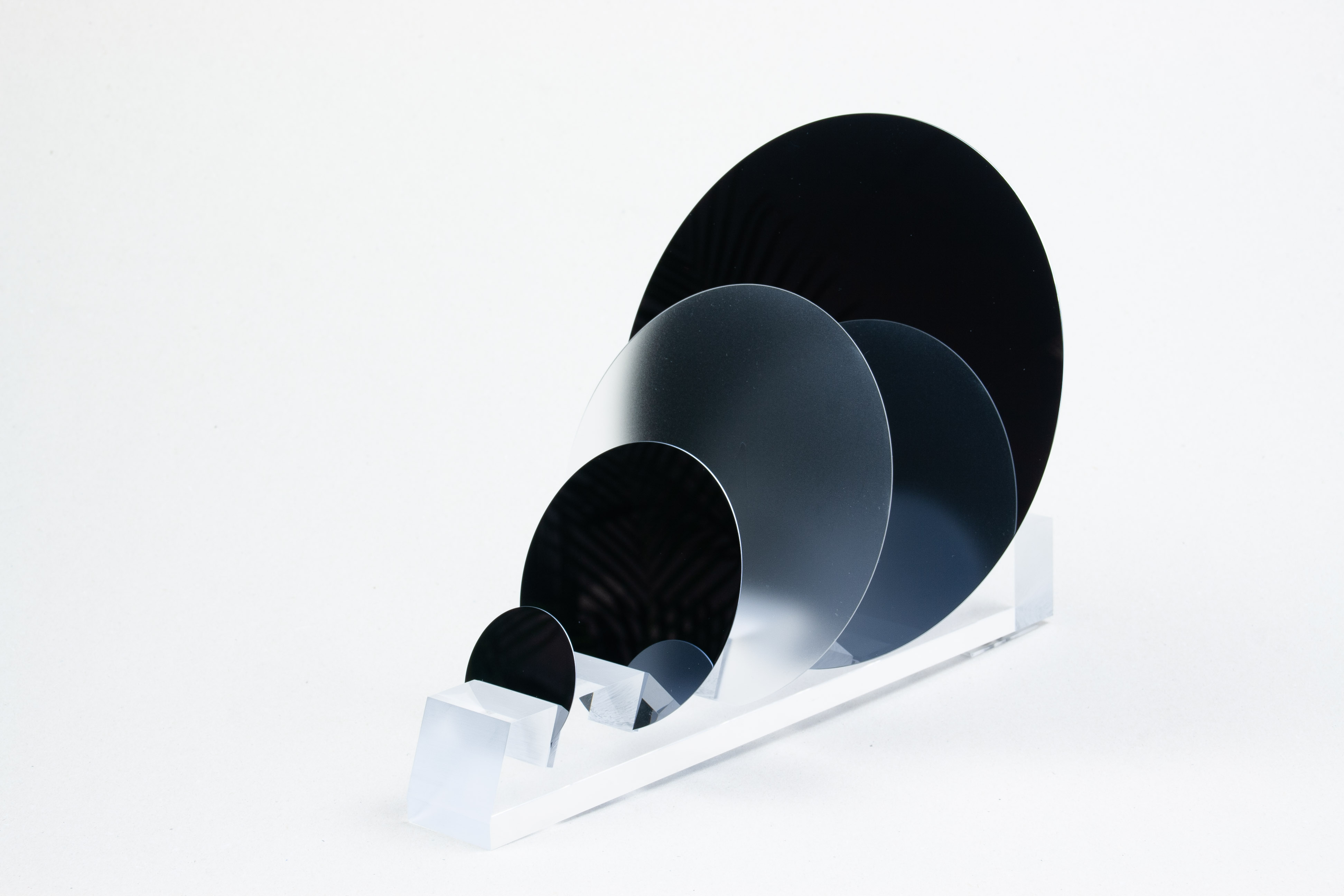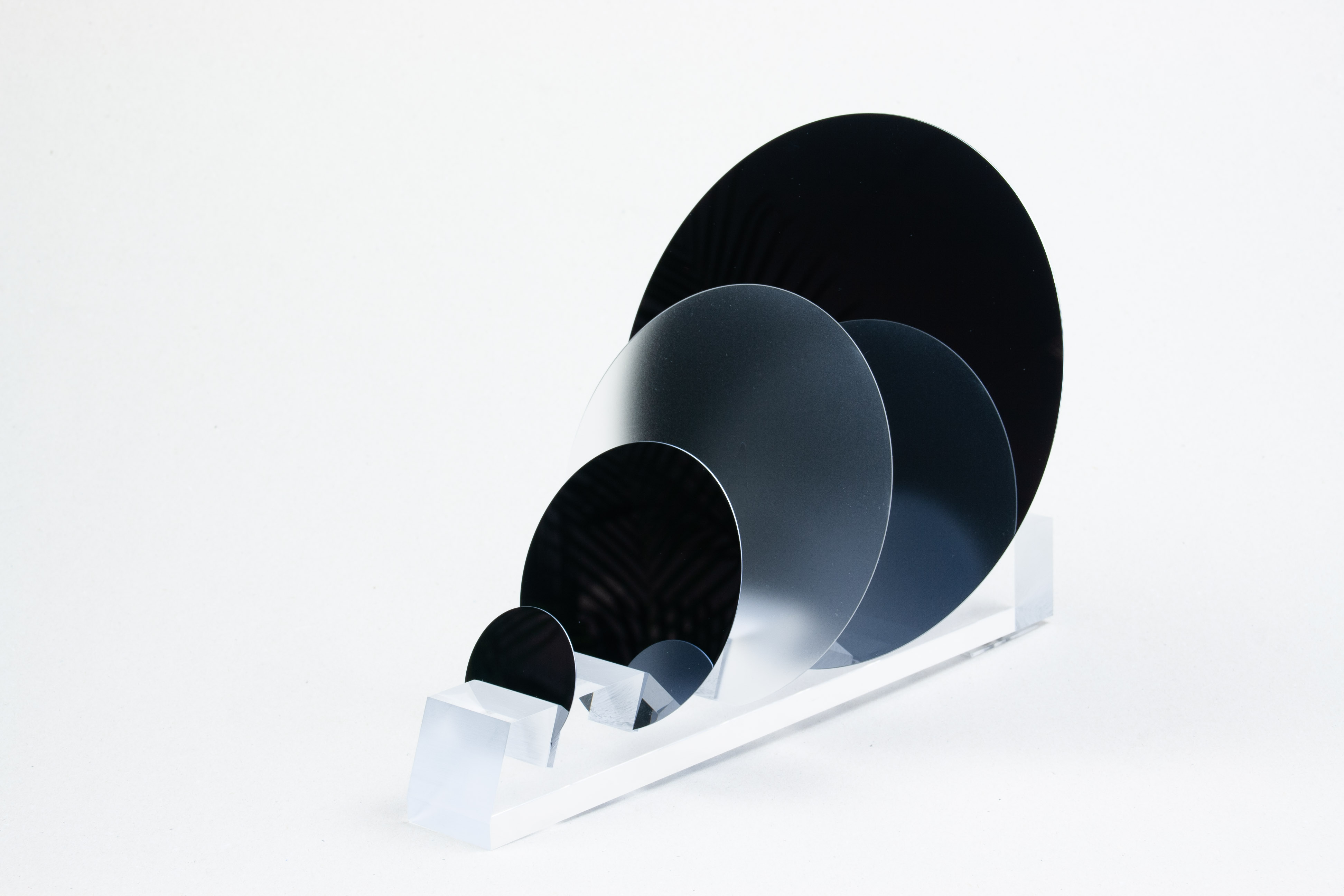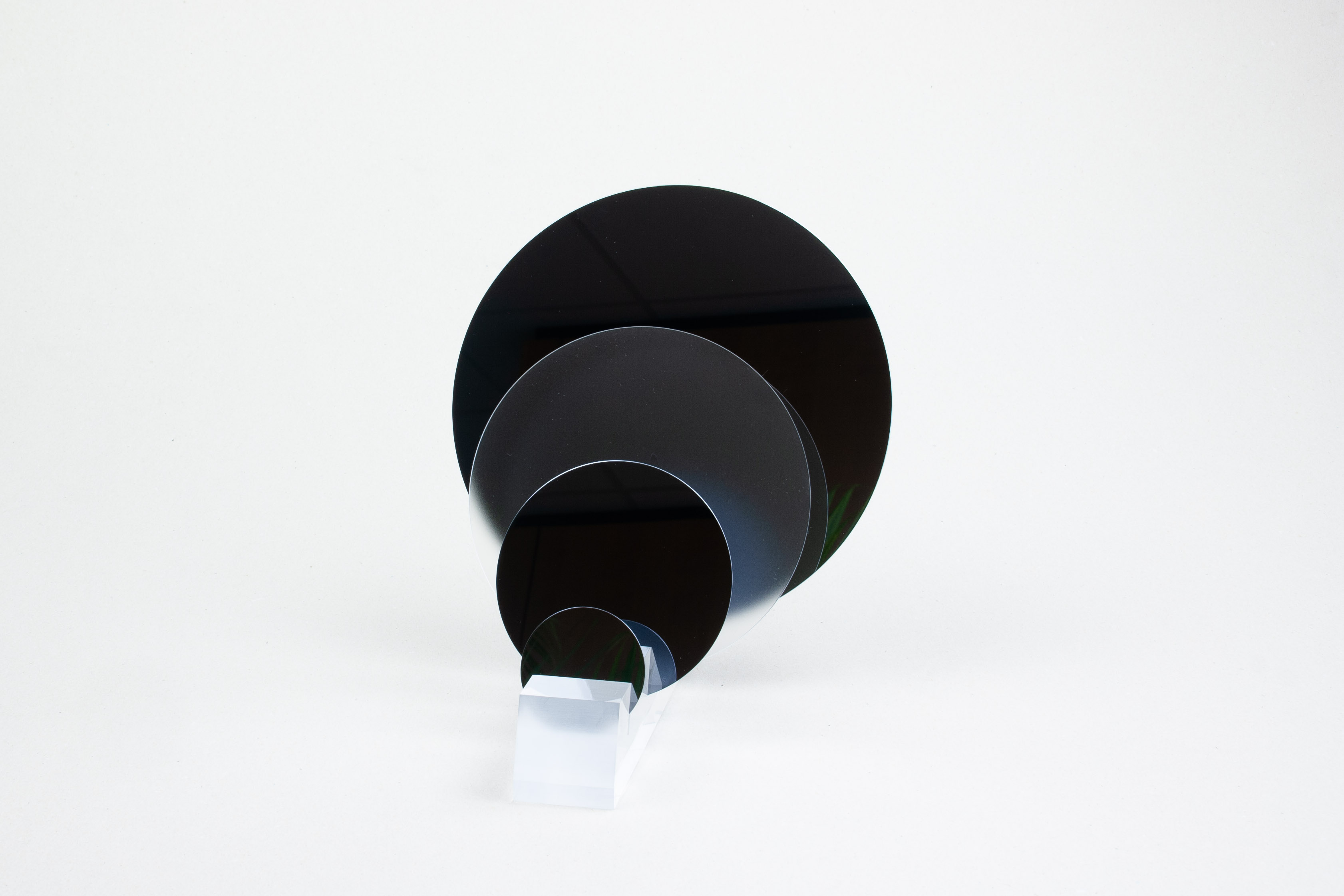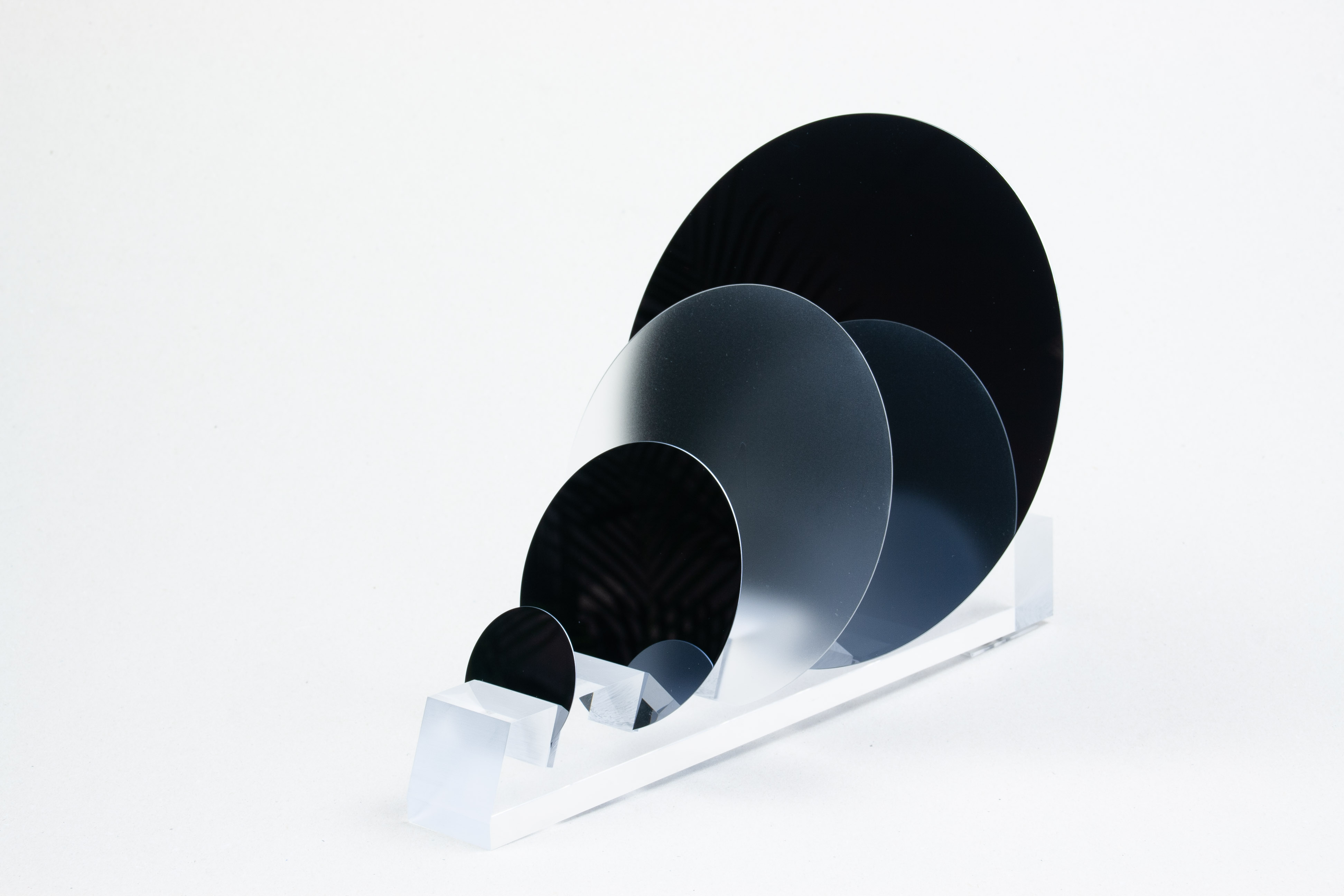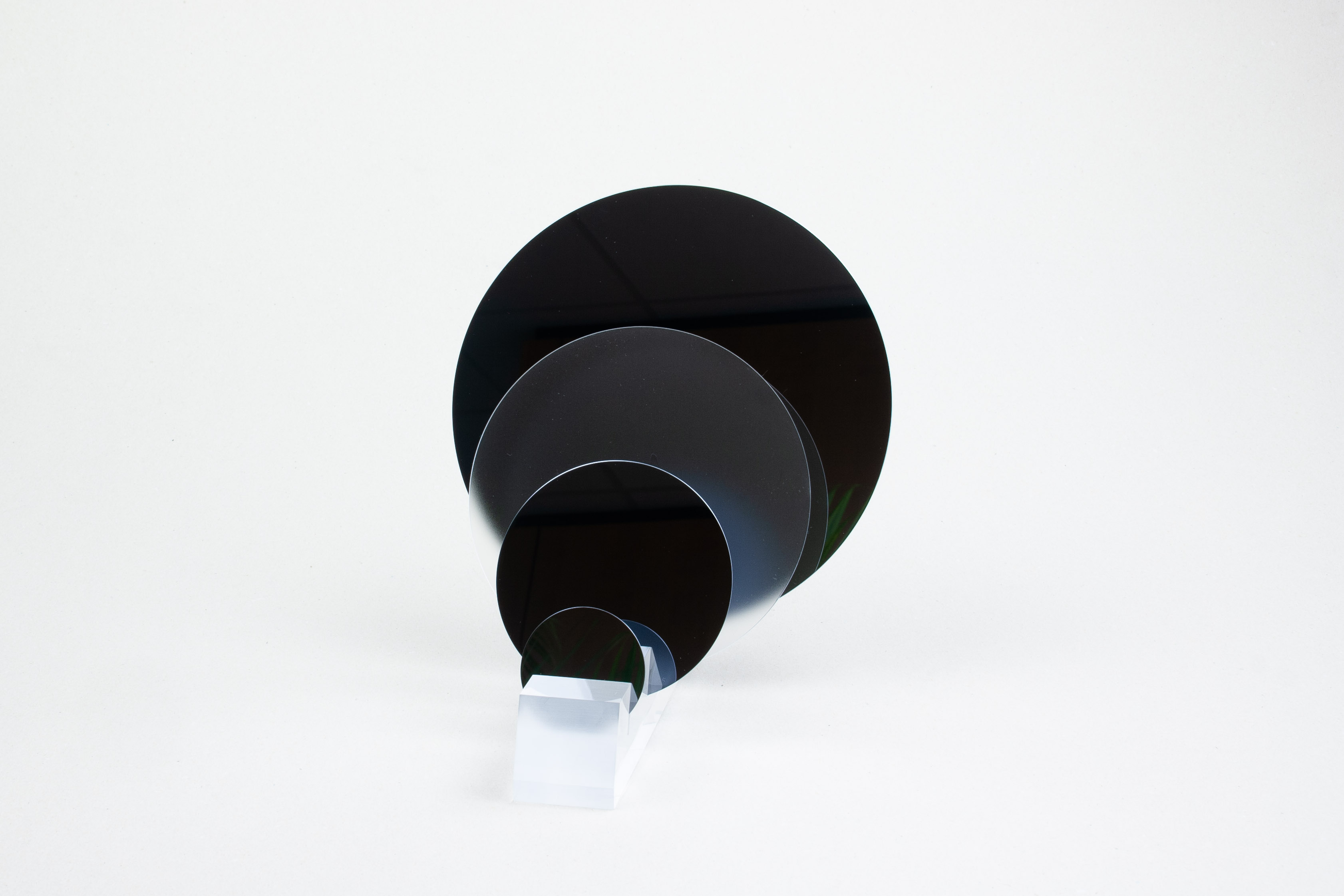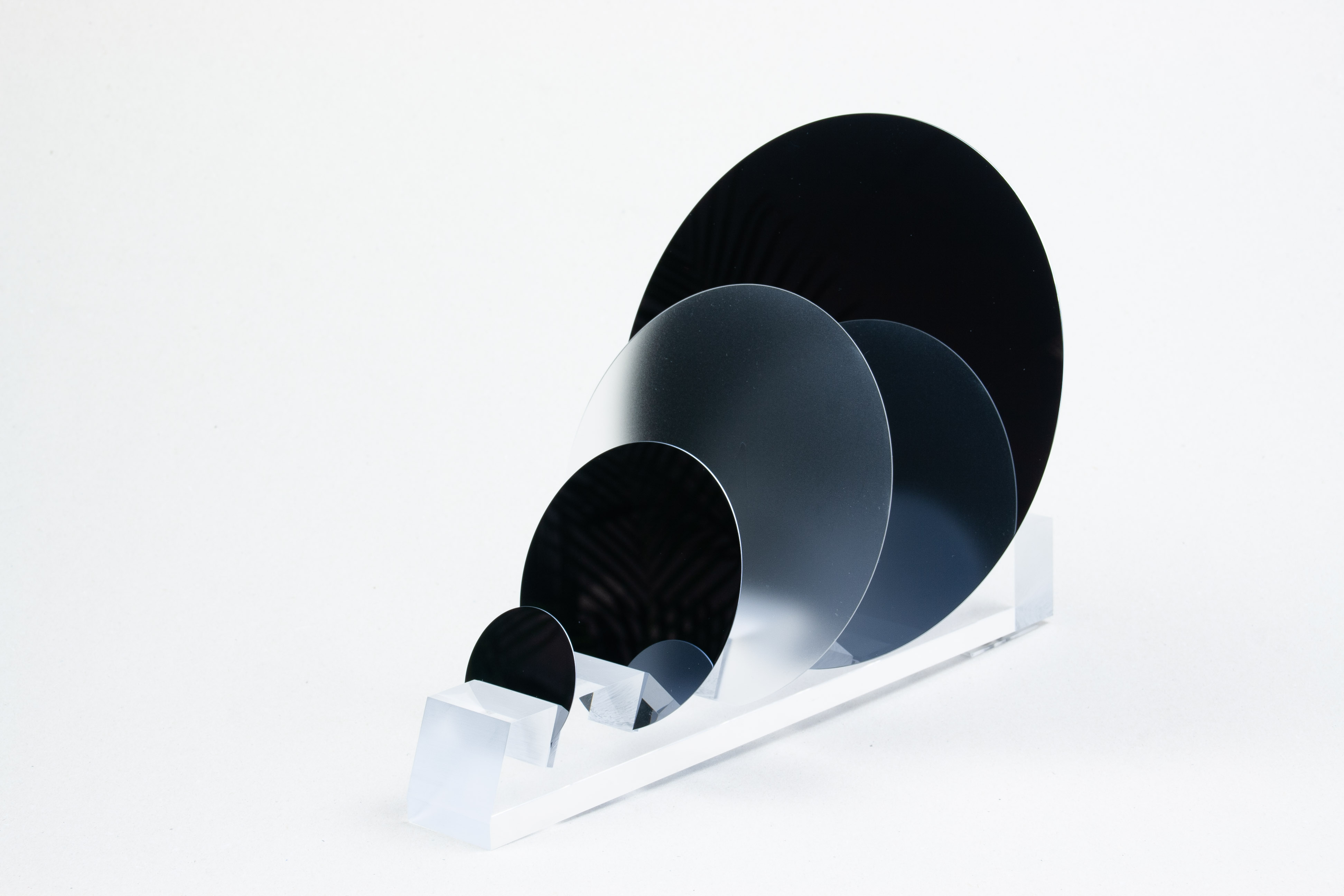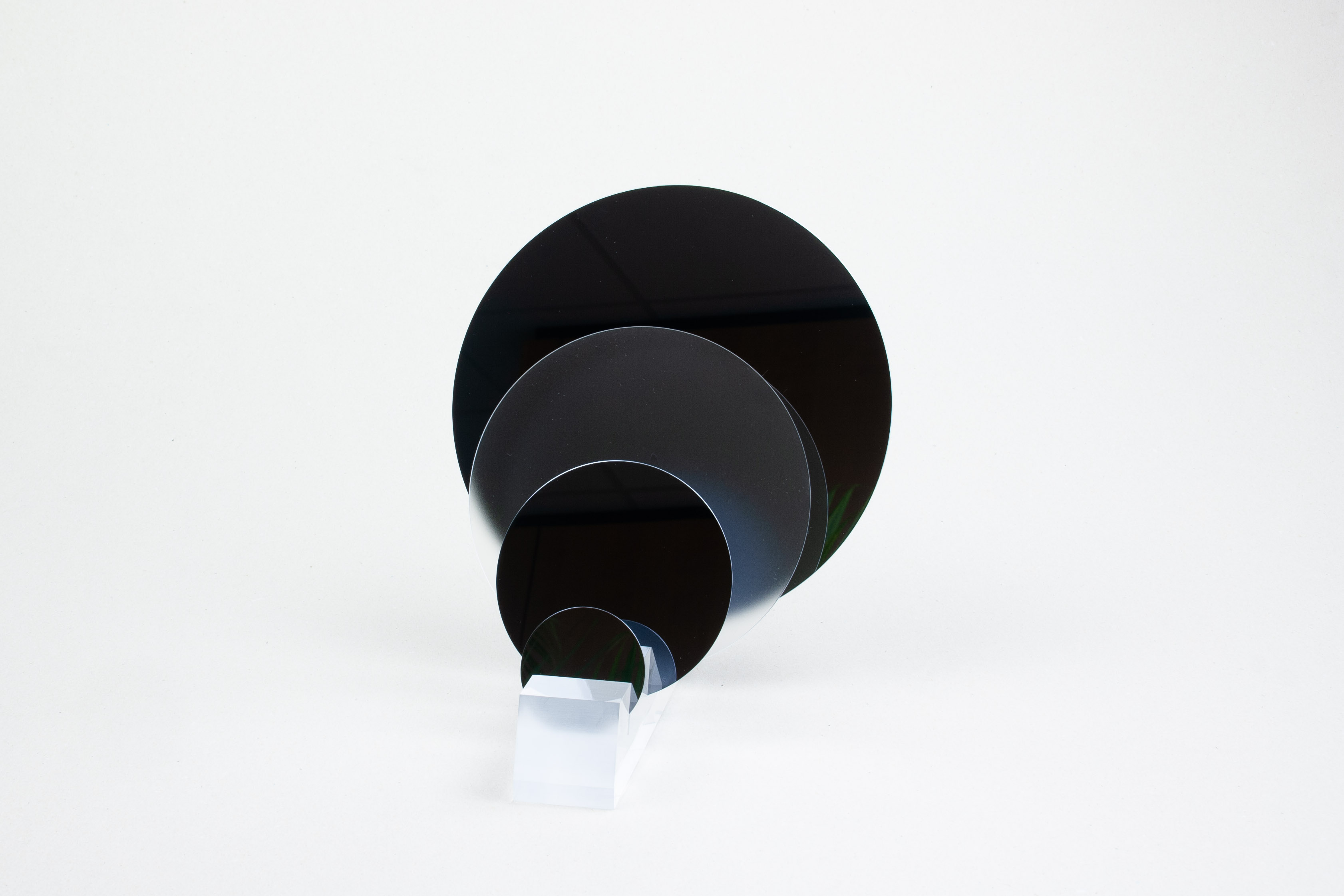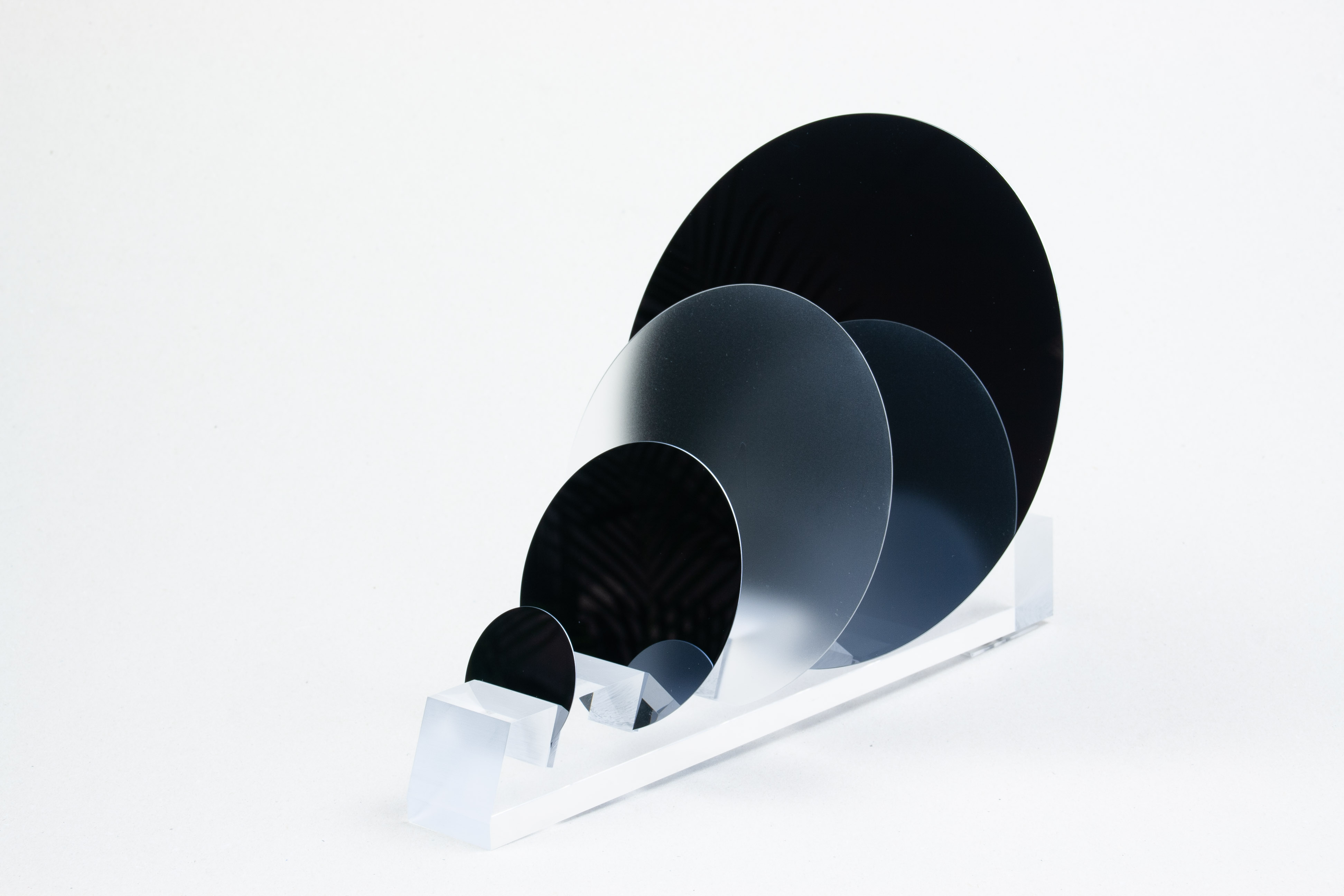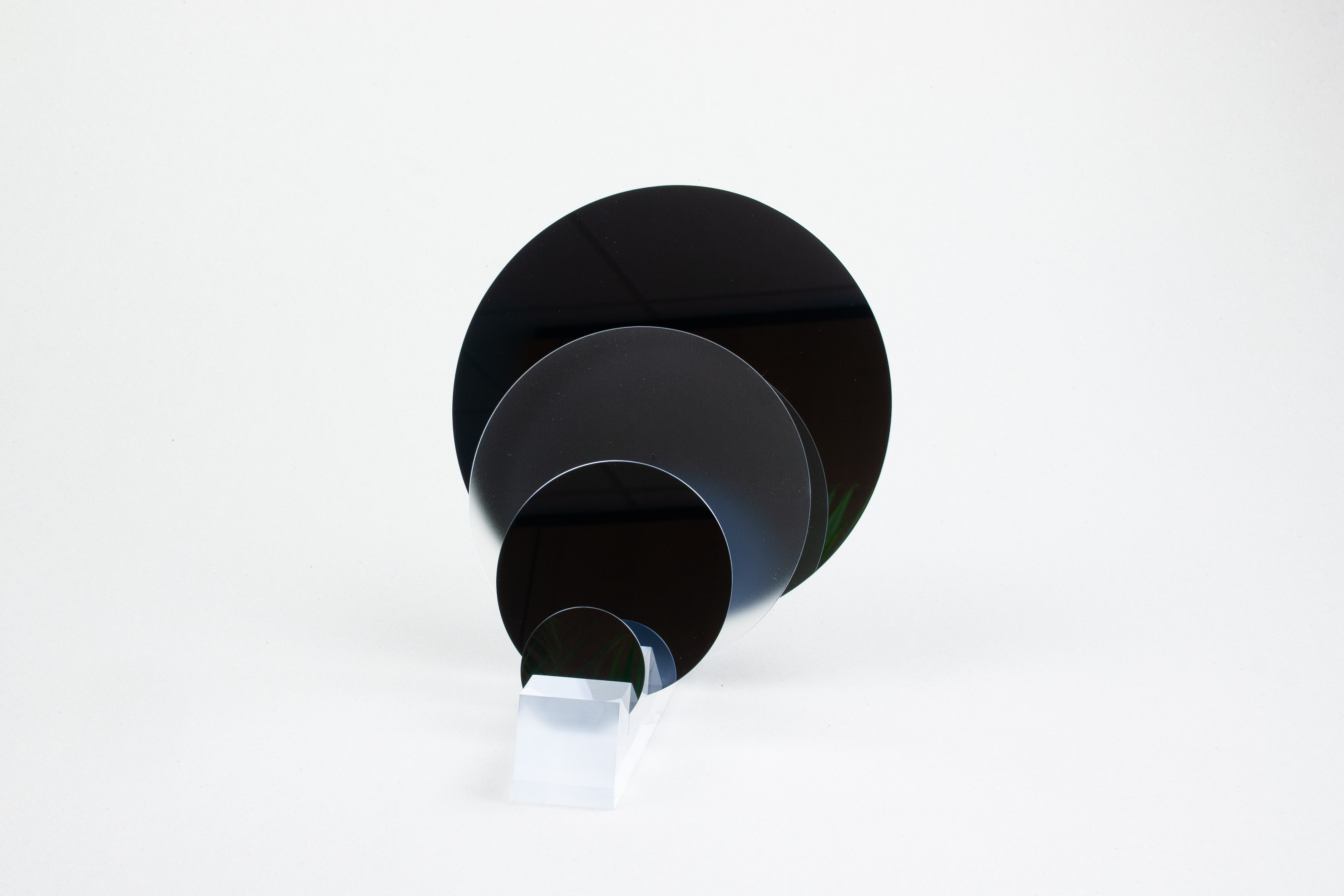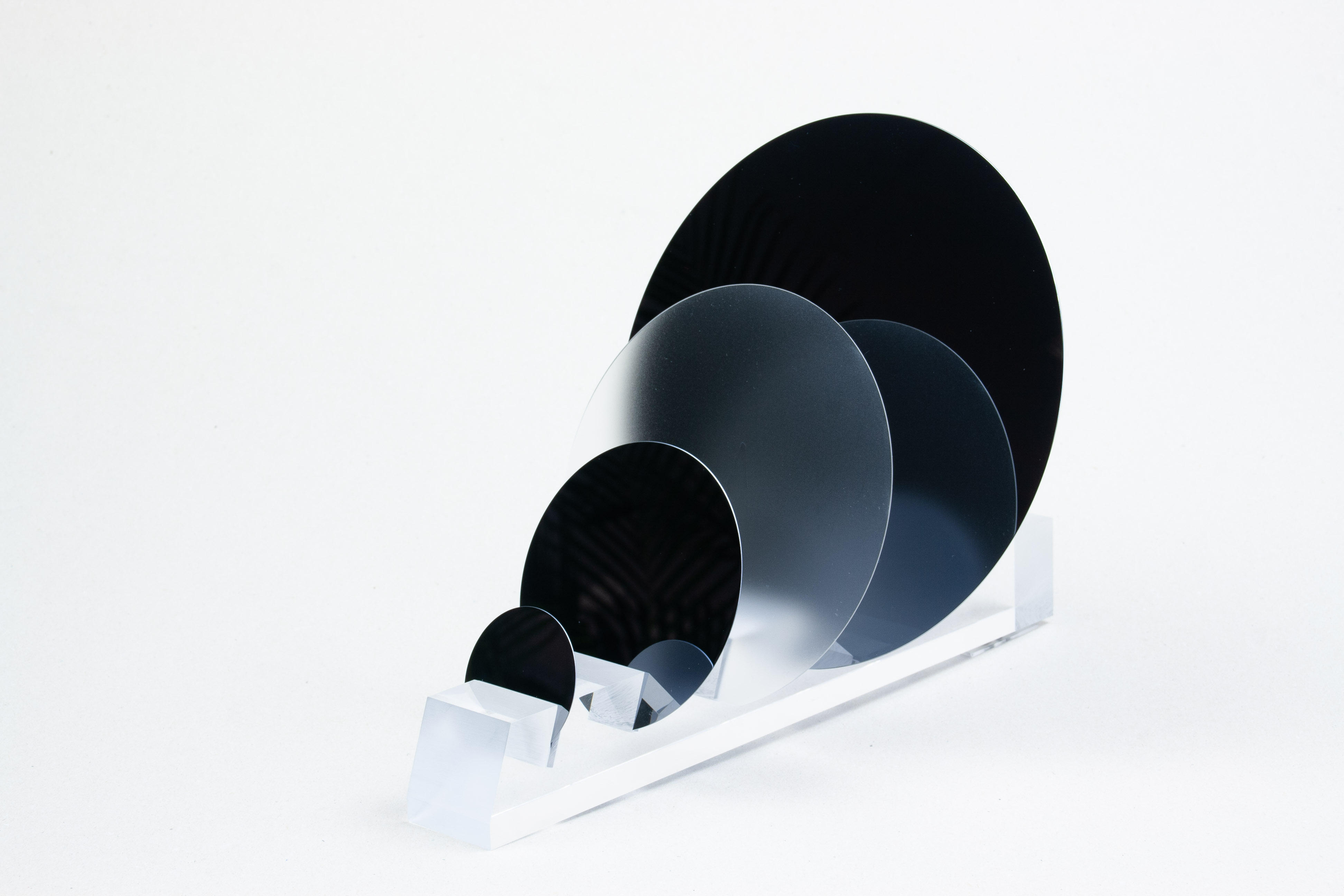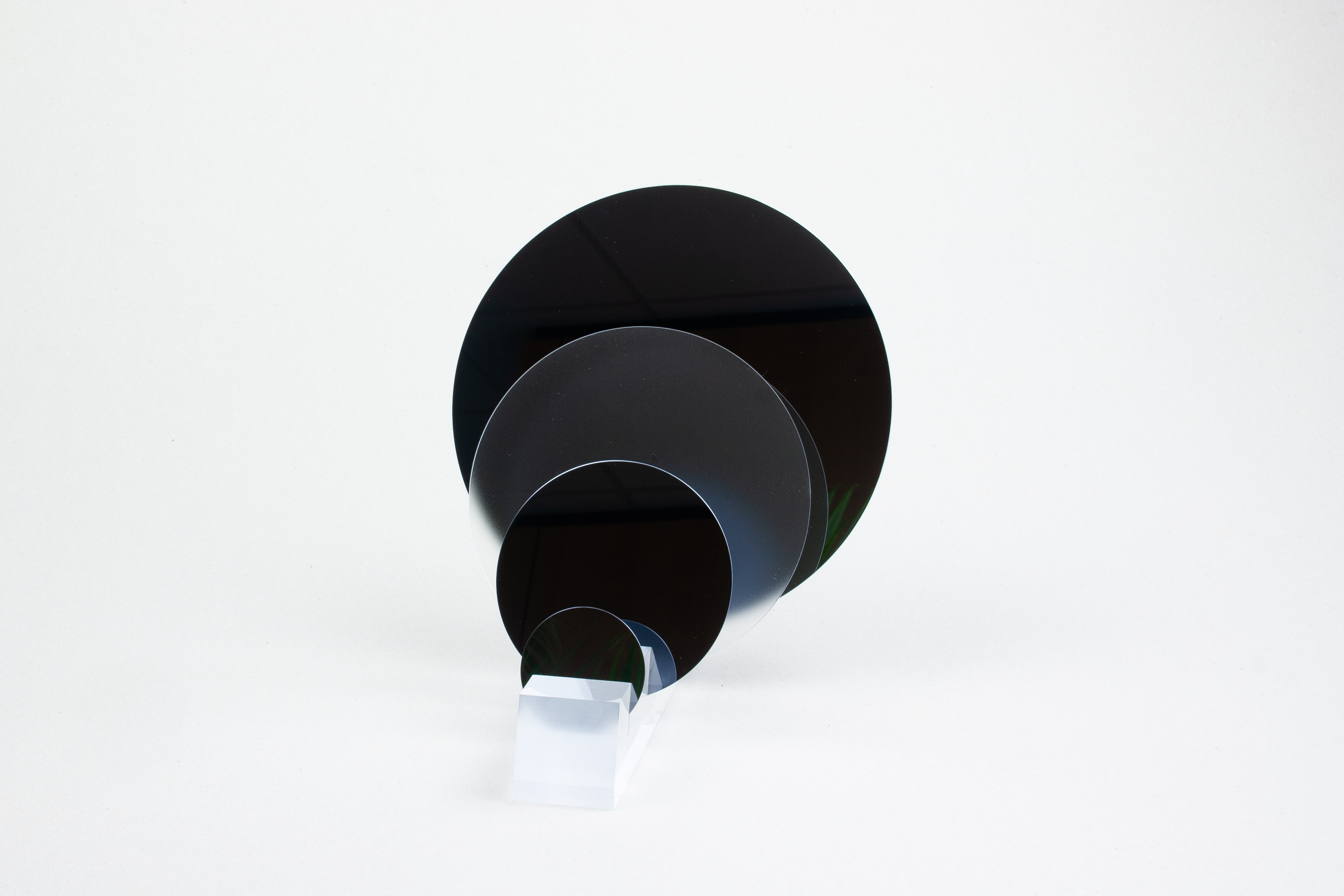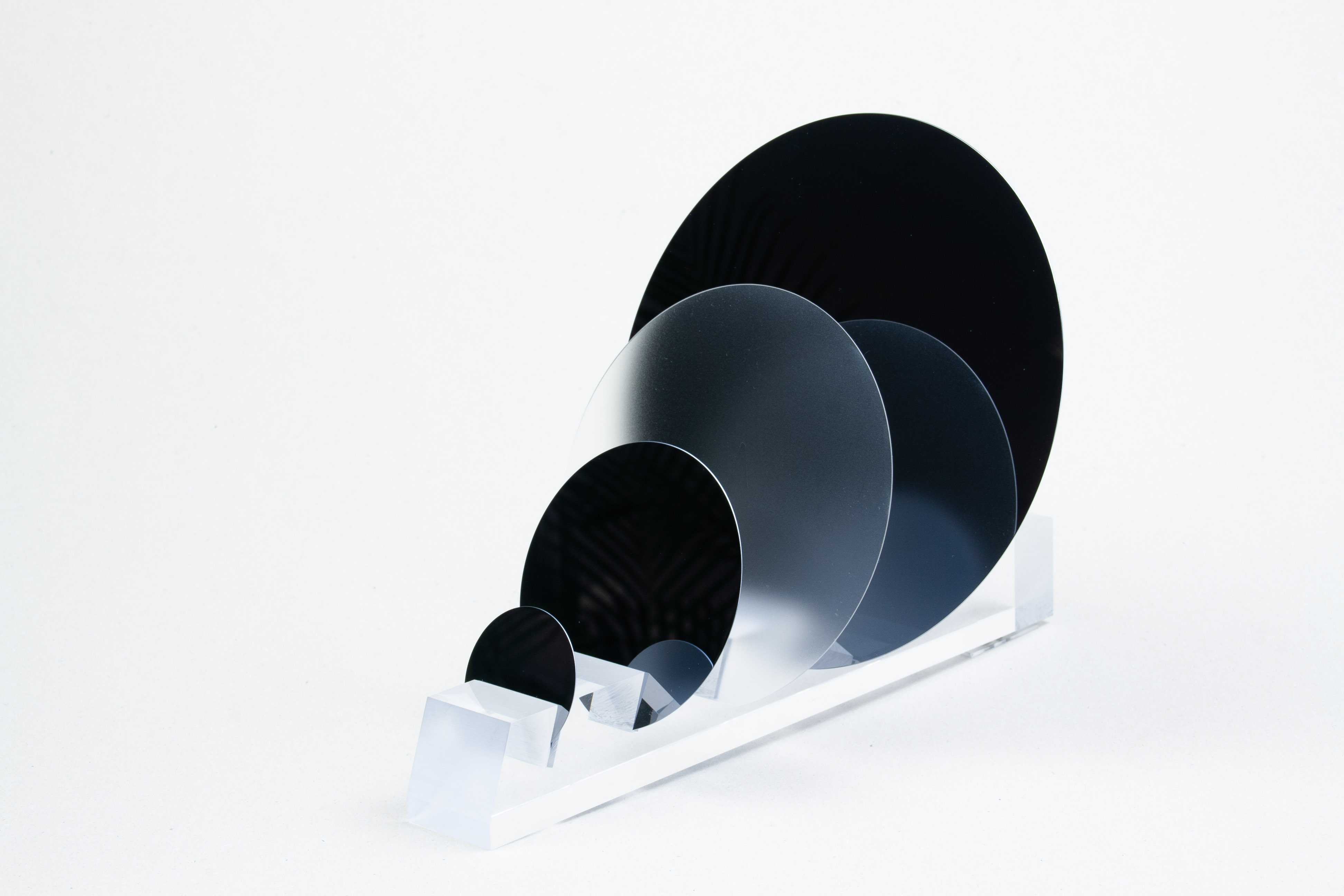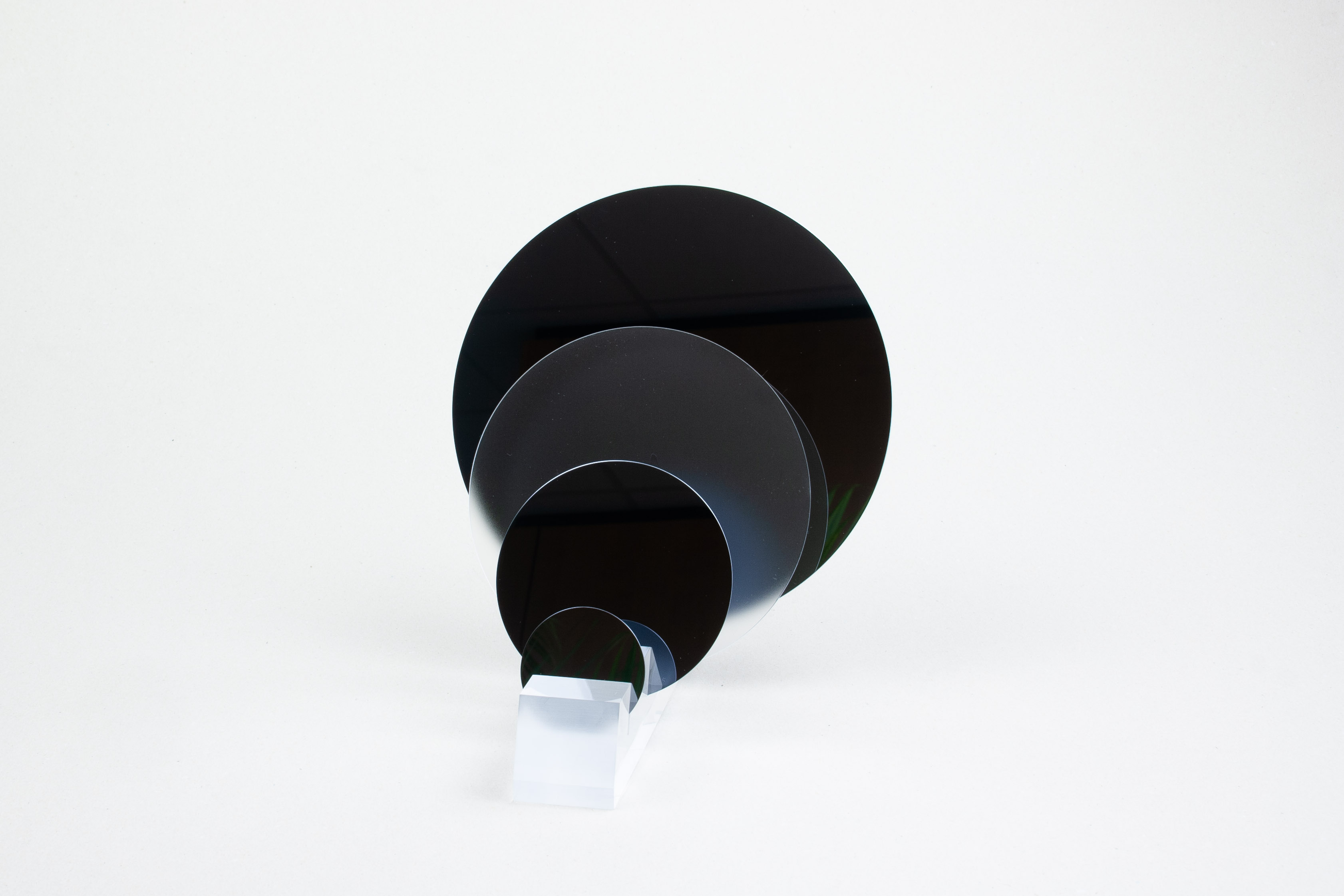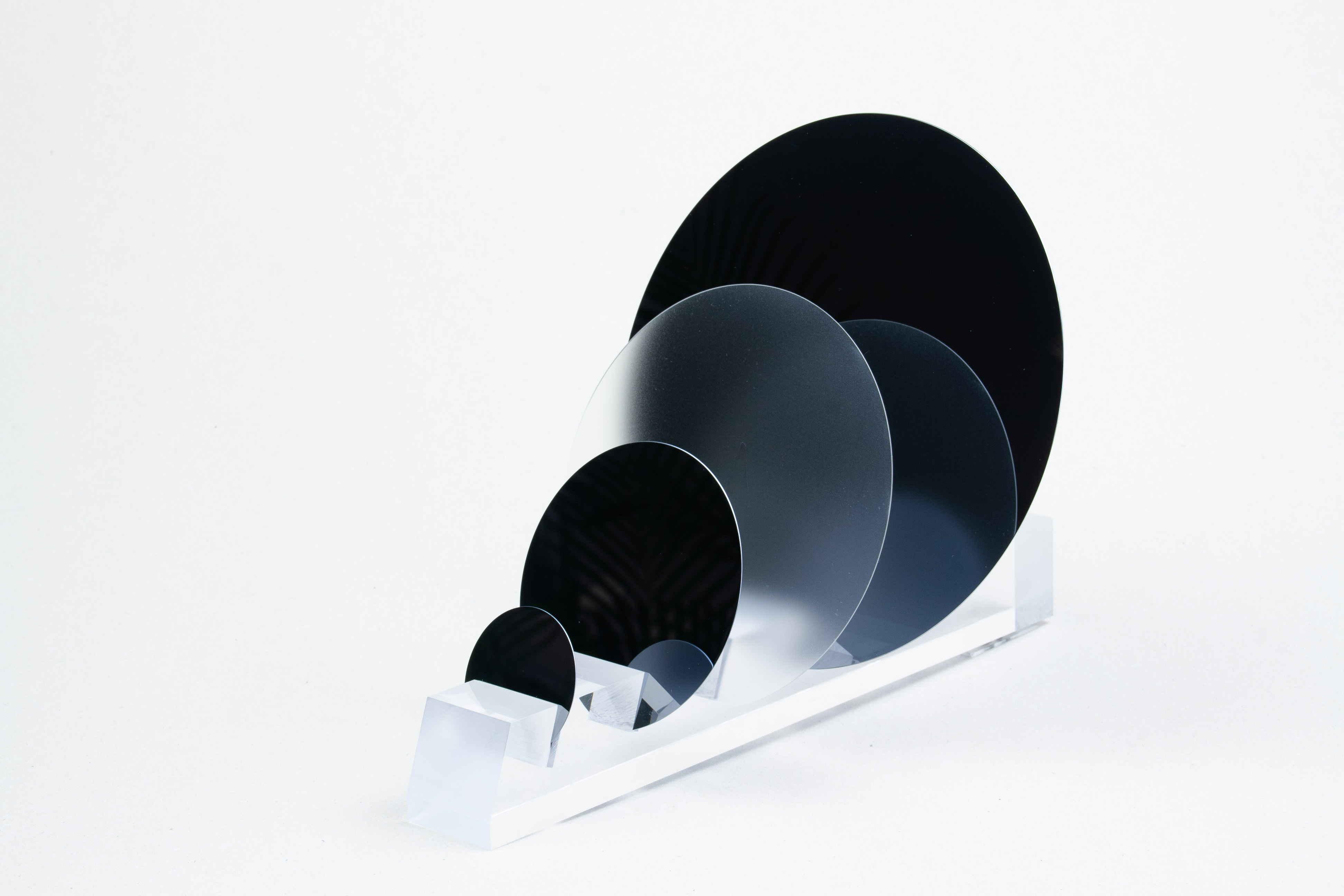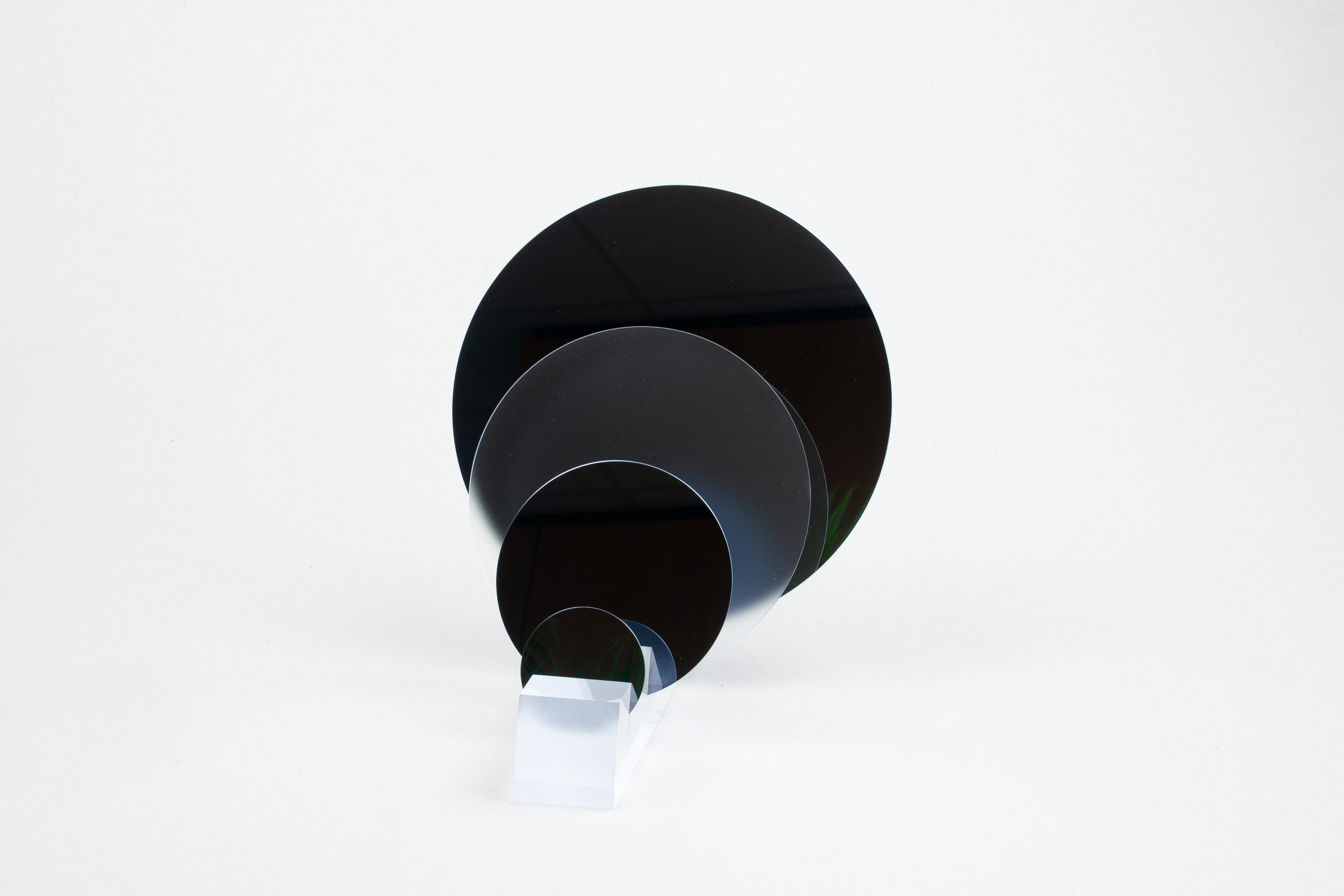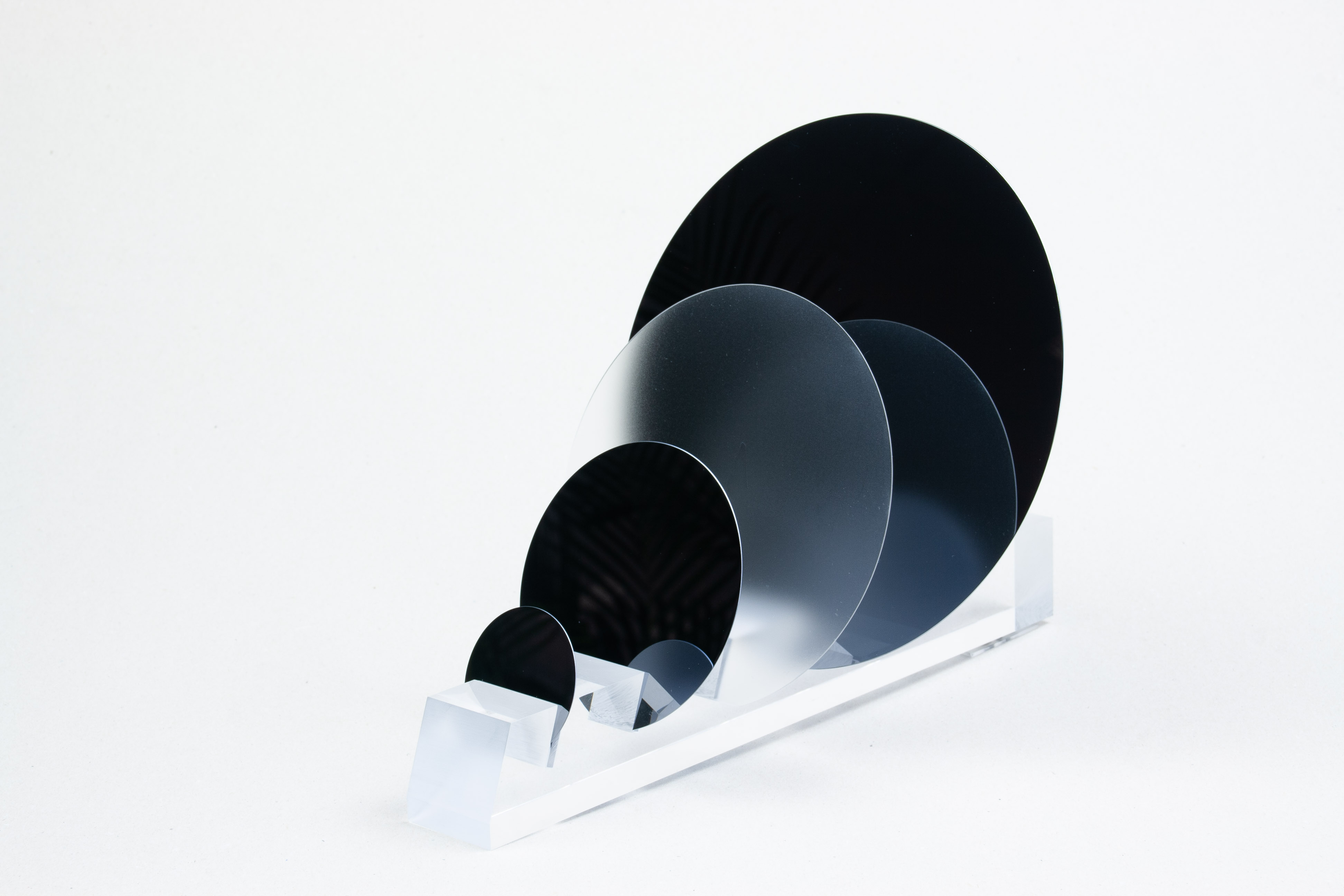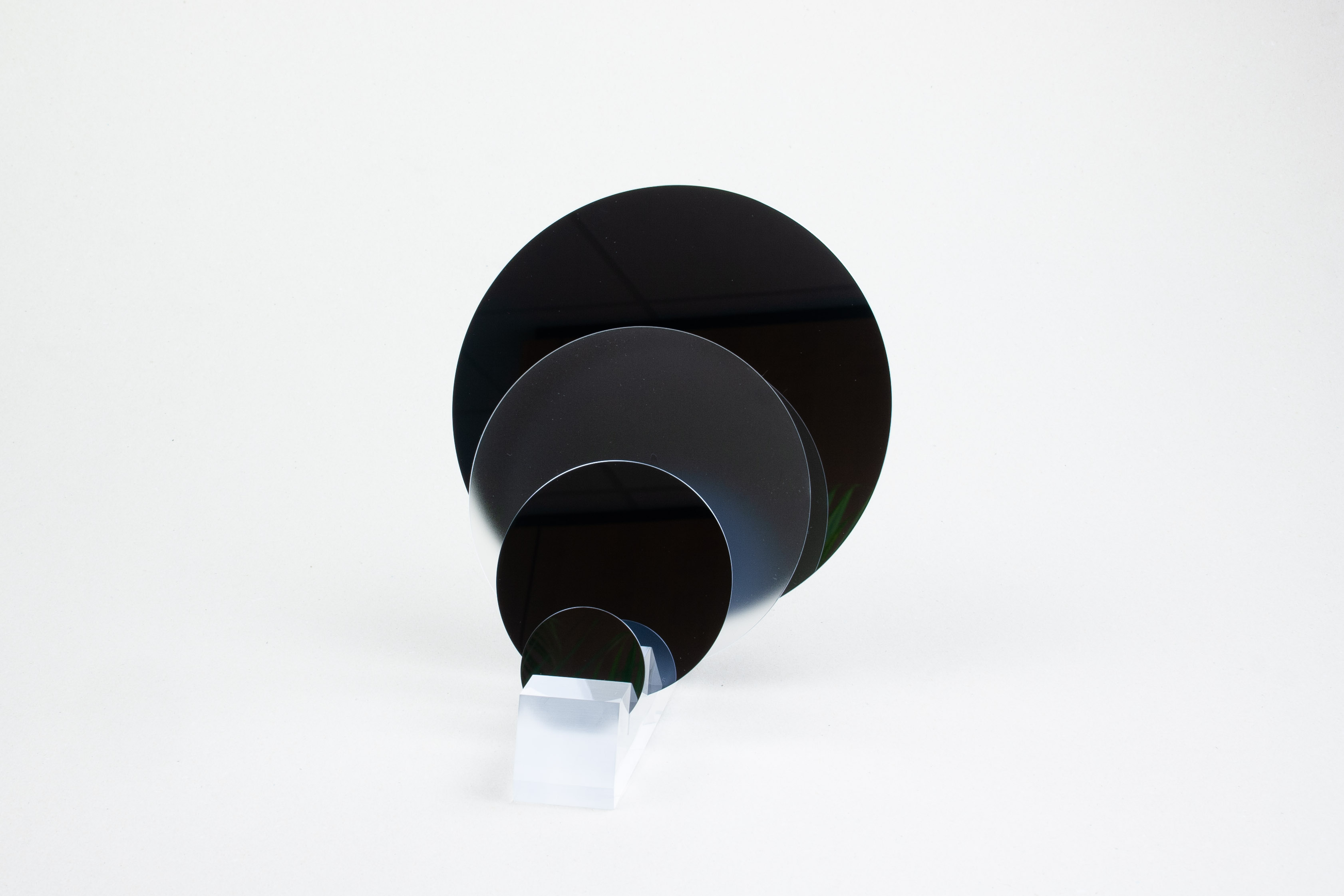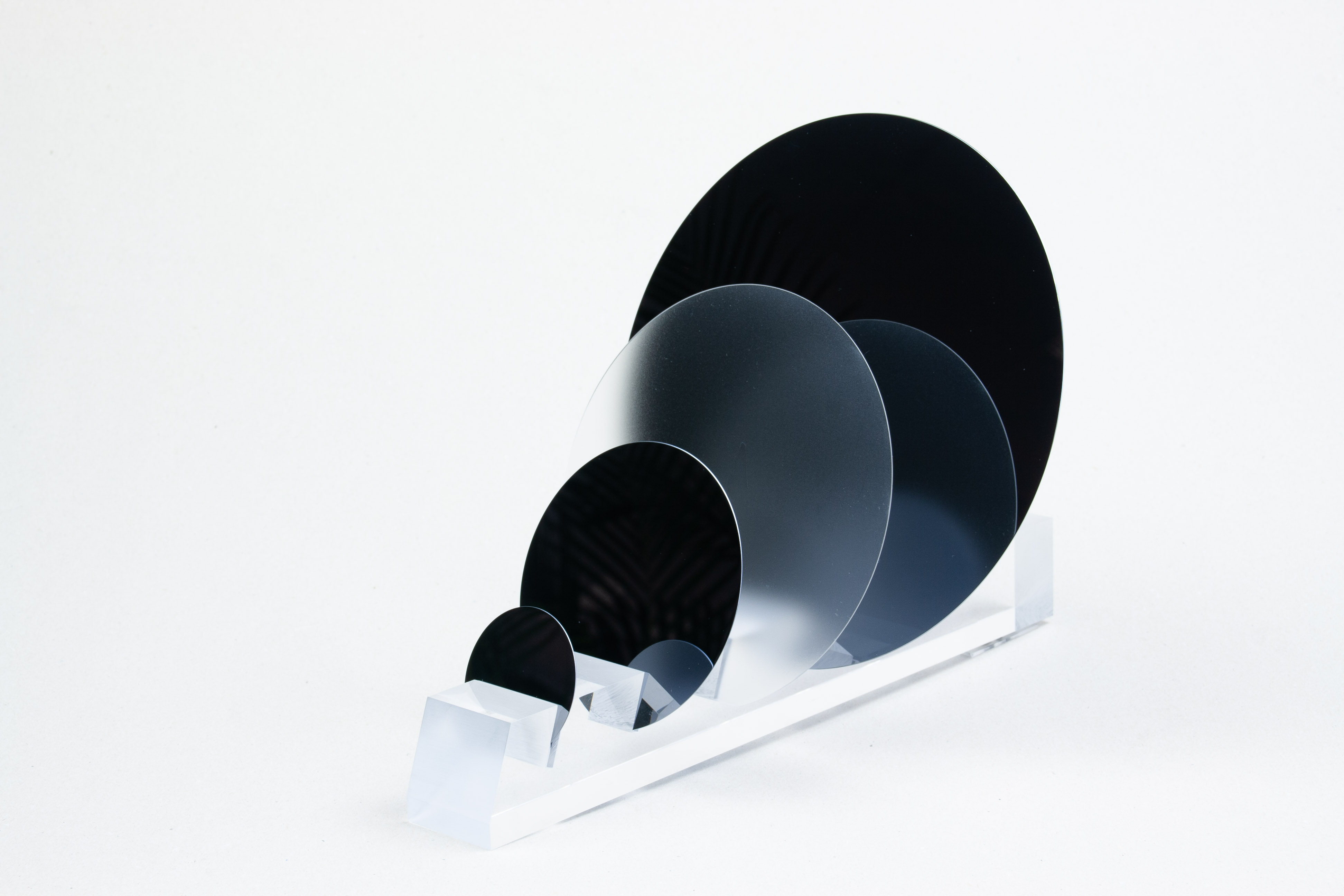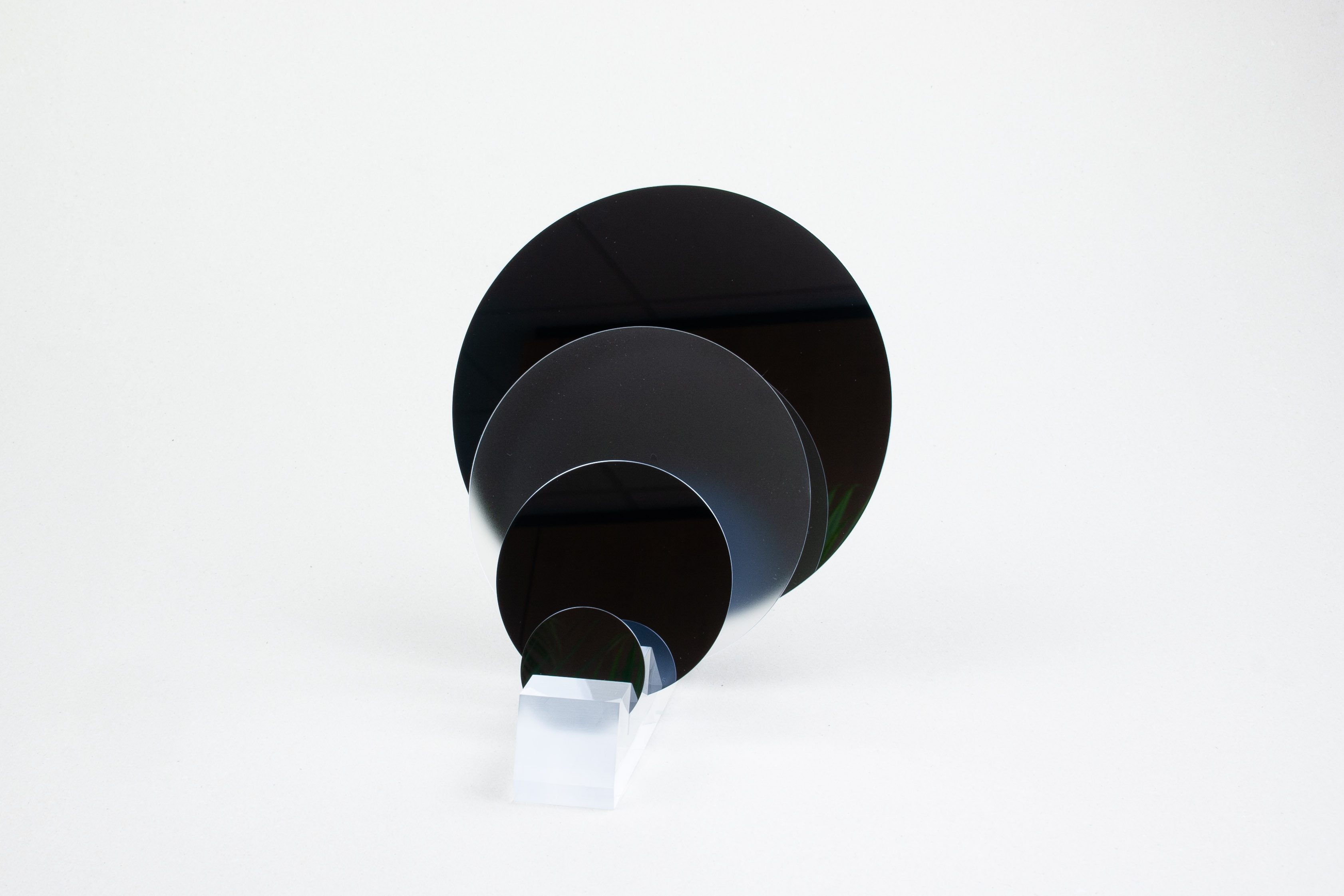HERSTELLUNG VON SI-EINKRISTALLEN
Kristallzucht mit dem Czochralski-Verfahren
Prinzip des Czochralski-Verfahren
Beim Czochralski-Verfahren wird wie in der Abbildung unten
schematisch dargestellt ein zylindrischer Silizium-Einkristall aus einer
Si-Schmelze gezogen. Hierzu wird zunächst polykristallines Silizium (z.
B. aus dem Siemens-Prozess stammend) zusammen mit Dotierstoff en in
einem Quarztiegel oberhalb 1400°C in einer Inertgas-Atmosphäre (z. B.
Argon) eingeschmolzen. Der Quarztiegel sitzt hierbei bündig in einem
Grafittiegel, welcher aufgrund seiner sehr hohen Wärmeleitfähigkeit die
Temperatur der Heizwandung gleichmäßig auf den Quarztiegel überträgt.
In
diese nun nahe über dem Schmelzpunkt von Silizium gehaltene Si-Schmelze
taucht ein Si-Einkristall („Impfkristall“ bzw. „Impfling“) der
gewünschten Kristall-Orientierung (z. B. <100>, <110> oder
<111>), woran das geschmolzene Silizium durch die Wärmeabfuhr über
den Impfling auszukristallisieren beginnt. Der Impfling wird langsam
aus der Schmelze gezogen, wobei der wachsende Kristall und der Tiegel
zur Optimierung der Homogenität des Kristalls und dessen Dotierung
gegenläufi g rotieren. Die Ziehgeschwindigkeit von typ. einigen
cm/Stunde bestimmt dabei den möglichst konstant gehaltenen Durchmesser
des wachsenden Si-Zylinders.
Vor dem Ende des Kristallwachstums wird
dessen Durchmesser durch eine Zunahme der Ziehgeschwindigkeit
kontinuierlich auf Null verringert um thermische Spannungen im Kristall
durch ein abruptes Heben aus der Schmelze zu vermeiden.
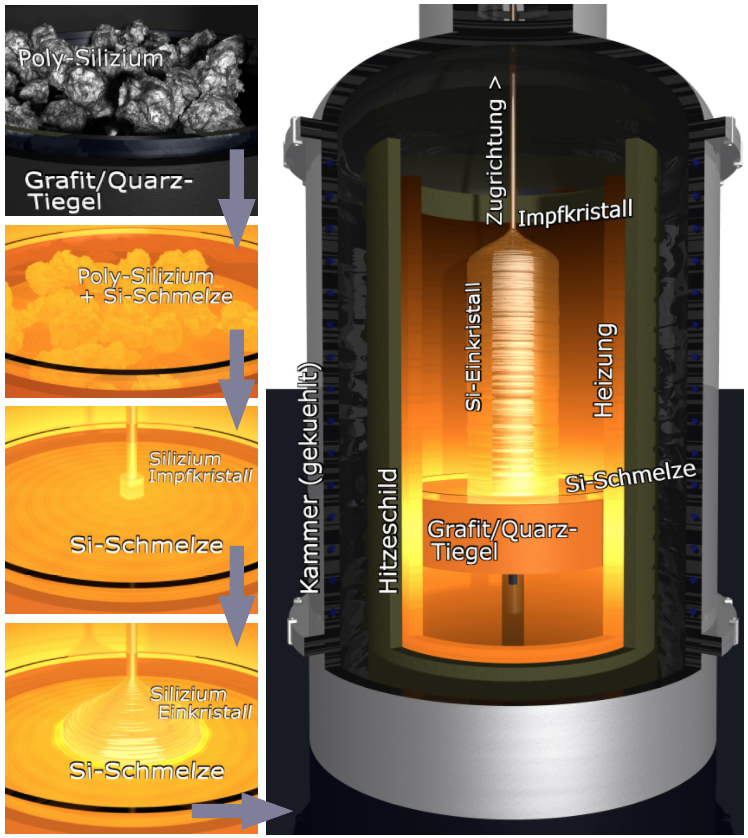
Die verschiedenen Schritte beim Ziehen von Si-Einkristallen über das Czochralski-Verfahren: Einschmelzen von polykristallinem Silizium mit Dotierstoffen, Eintauchen des Impfkristalls, und Ziehen des Einkristalls.
Vor-und Nachteile des Czochralski-Verfahren
Die Vorteile des Czochralski-Verfahrens sind große mögliche
Kristalldurchmesser (derzeit bis 18 Zoll = 46 cm) sowie – verglichen mit
dem im nächsten Abschnitt erläuterten Float-Zone-Verfahren – geringere
Kosten der daraus hergestellten Wafer.
Ein Nachteil des Czochralski-Verfahrens sind Verunreinigungen durch die Tiegelwand mit Sauerstoff (ca. 1018 cm-3), Kohlenstoff (ca. 1017 cm-3)
und Metallen welche die Minoritäten-Lebensdauer im Silizium
herabsetzen. Ein weiterer Nachteil ist die relativ ungleichmäßige
Dotierung über das gesamte Kristall-Volumen, wodurch keine gleichmäßig
sehr gering dotierten, hochohmigen CZ-Wafer mit Widerständen über ca.
100 Ohm cm möglich sind. Ein Magnetfeld am Ort der Schmelze („Magnetic
Czochralski”, MCZ) kann nicht-stationäre Strömungen der Schmelze
unterdrücken, was die Homogenität der im Kristall eingebauten
Dotierstoffkonzentration deutlich verbessert und so hoch-ohmige CZ-Wafer
möglich macht.
Kristallzucht mit dem Float-Zone-Verfahren
Prinzip des Float-Zone Verfahrens
Beim Float-Zone- (FZ) bzw. Zonenschmelzverfahren wird, wie in der
unten gezeigten Abbildung schematisch dargestellt, ein einkristalliner
Silizium-Impfkristall
mit einem polykristallinen Si-Zylinder in Berührung gebracht. Von
dieser Stelle ausgehend bringt eine Induktionsspule das Poly-Silizium in
einer räumlich begrenzten Zone zum Schmelzen. Beim Abkühlen
kristallisiert die Schmelze und nimmt hierbei die Kristallorientierung
(z. B. <100>, <110> oder <111>) des Impflings an.
Verunreinigungen sind beim Einbau in das entstehende Kristallgitter
gegenüber Silizium energetisch benachteiligt (geringeres chemisches
Potenzial), so dass diese sich in der Schmelze anreichern und nach
Abschluss des Zonenschmelzverfahrens am Ende des Kristalls konzentriert
vorliegen, wo sie abgetrennt werden können. Die Dotierung erfolgt über
der Schutzgasatmosphäre zugesetztes Phosphin (PH3), Arsin (AsH3) oder Diboran (B2H6).
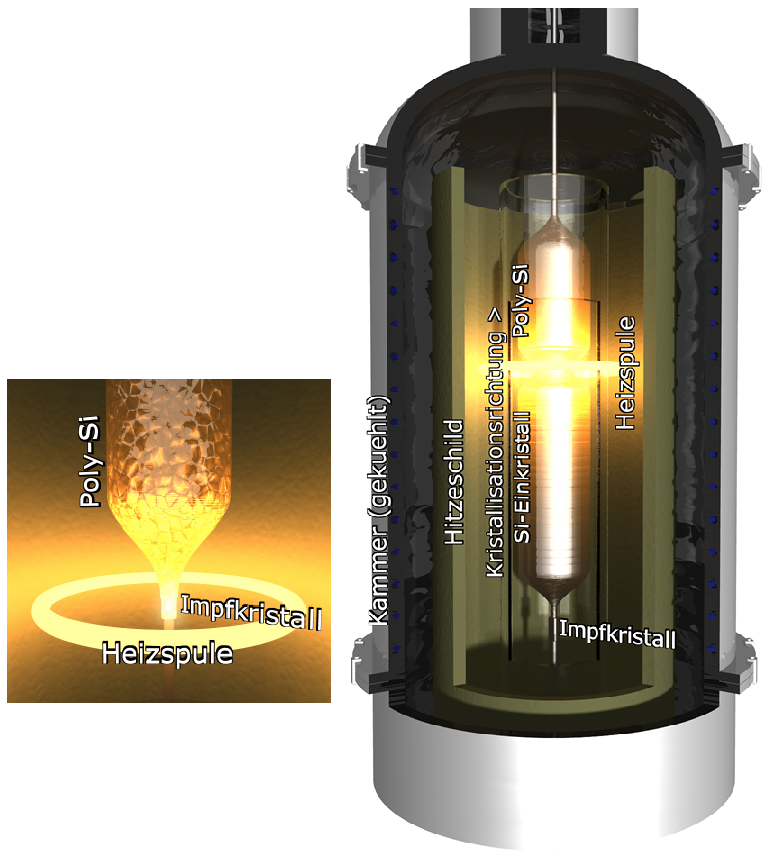
Schema des Zonenschmelzverfahrens: Nach dem Anschmelzen eines Si-Einkristalls an einen Poly-Si Zylinder (oben) nimmt dieser der Länge nach durch Schmelzen und Auskristallisieren die Kristallrichtung des Impflings an.
Vor-und Nachteile des Float-Zone Verfahrens
Der Hauptvorteil des Float-Zone Verfahrens ist die Möglichkeit, die
Dotierstoffkonzentration auch auf sehr geringem Level mit großer
Homogenität vorzugeben, wodurch sehr hoch-ohmige (1.000 - 10.000 Ohm cm)
und bzgl. des Widerstands sehr eng spezifizierte Wafer realisierbar
sind. Zudem ist die Verunreinigung mit Fremdstoffen wesentlich geringer
(Sauerstoff und Kohlenstoff < 1016 cm-3) als beim CZ-Verfahren, da die
Si-Schmelze
nicht mit Quarz in Kontakt kommt und keine Grafittiegel verwendet
werden. Ein Nachteil des FZ-Verfahrens sind die relativ hohen Kosten,
verglichen mit dem Czochralski-Verfah-ren typischerweise ein Drei- bis
Vierfaches bezogen auf den fertigen Wafer. Aus technischen Gründen ist
der Durchmesser des Einkristalls begrenzt und erlaubt beim derzeitigen
Stand der Technik max. acht Zoll durchmessende FZ-Wafer.
Weitere Informationen:
> Herstellung von Silizium-Einkristallen